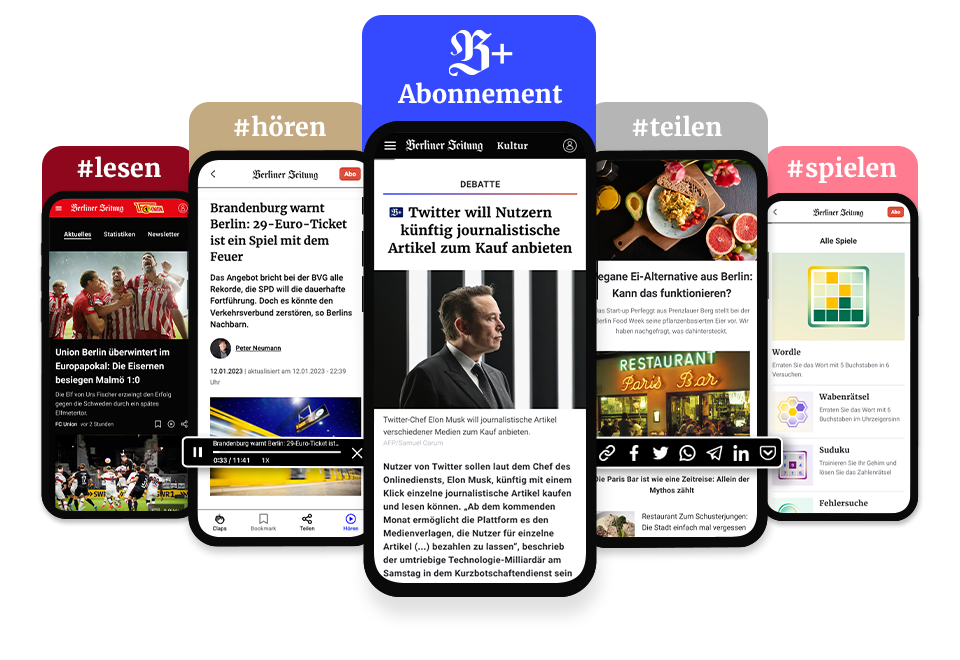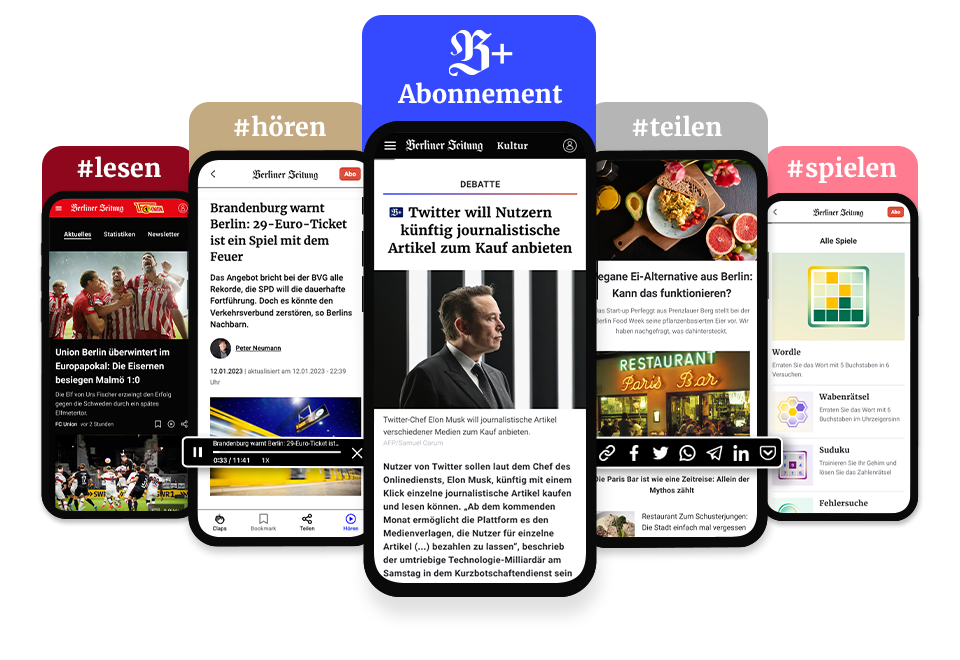
Mit einem Abo weiterlesen
- Zugriff auf alle B+ Inhalte
- Statt 9,99 € für 2,00 € je Monat lesen
- Jederzeit kündbar
Aus dem Haus der Kulturen infolge von Antisemitismusvorwürfen ausgeladen, war Chefket nun für seinen Tourabschluss im Festsaal Kreuzberg zu Gast. Was hatte er zu sagen?