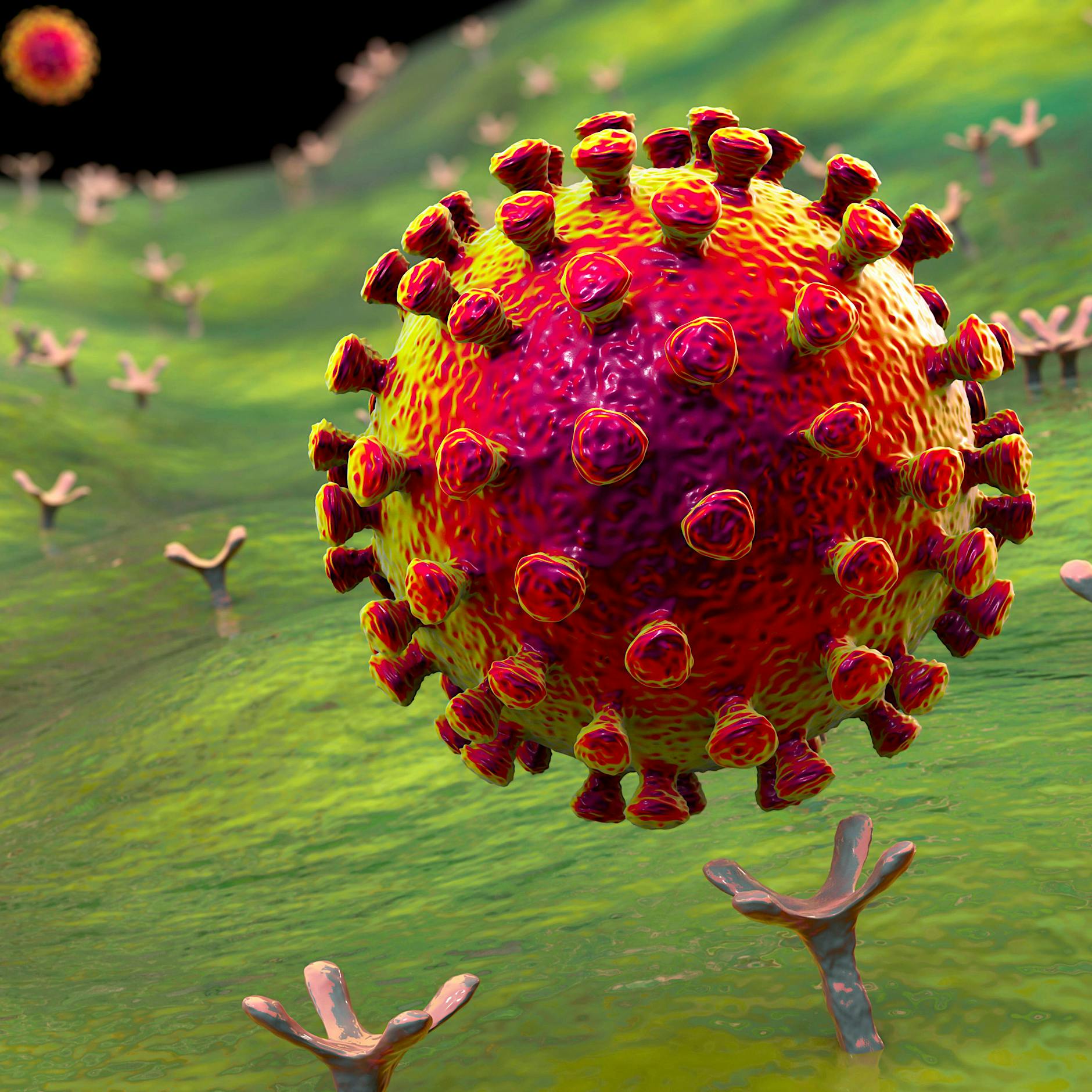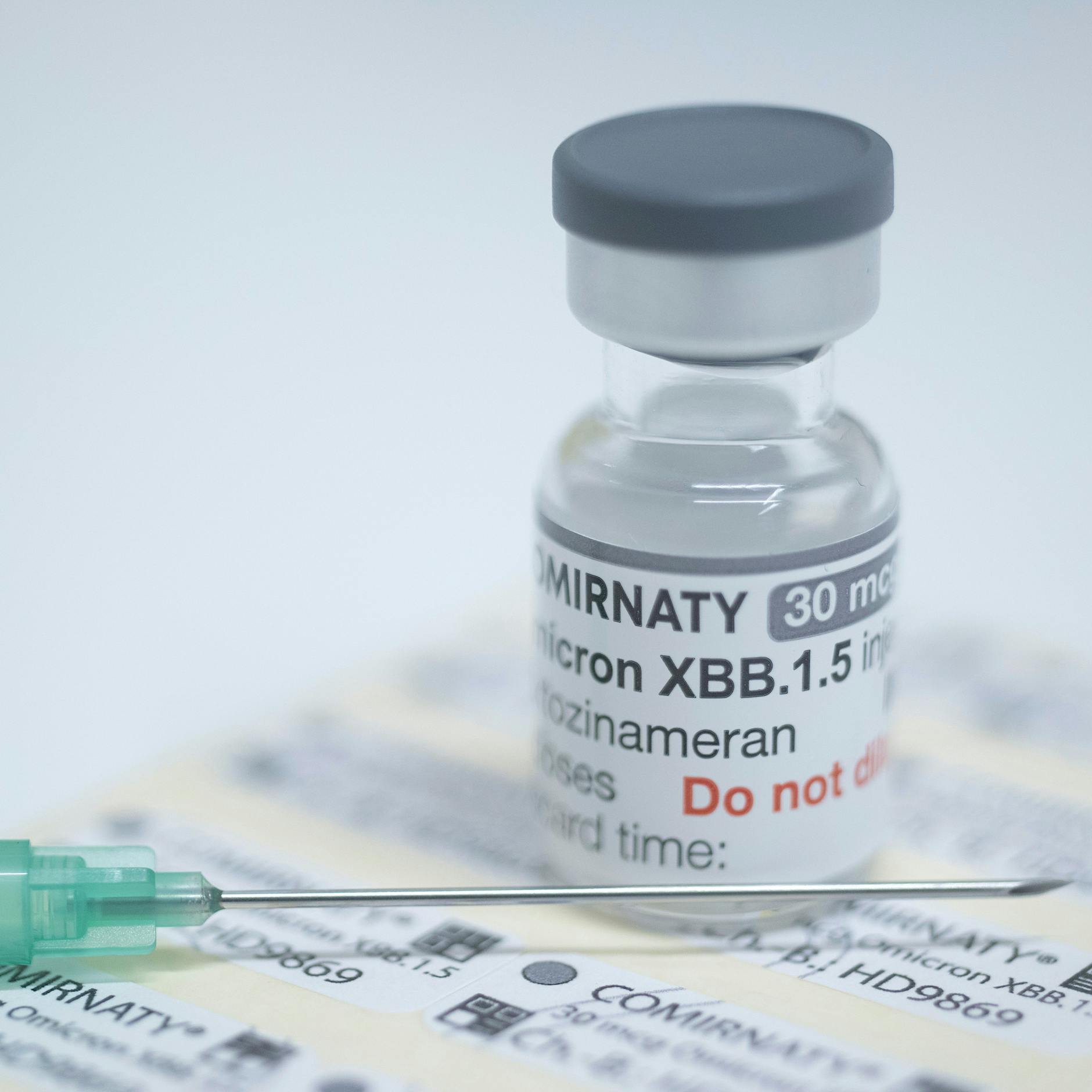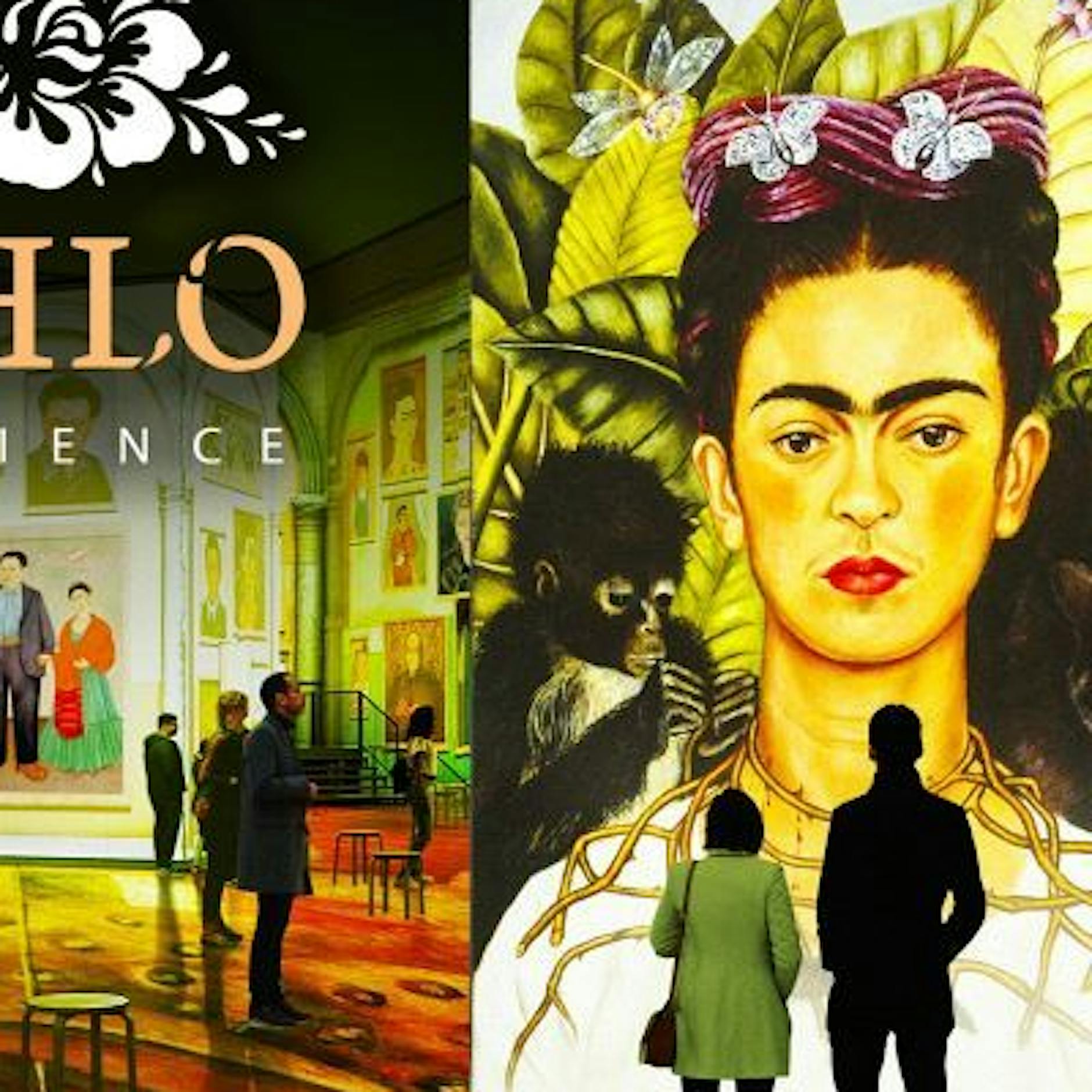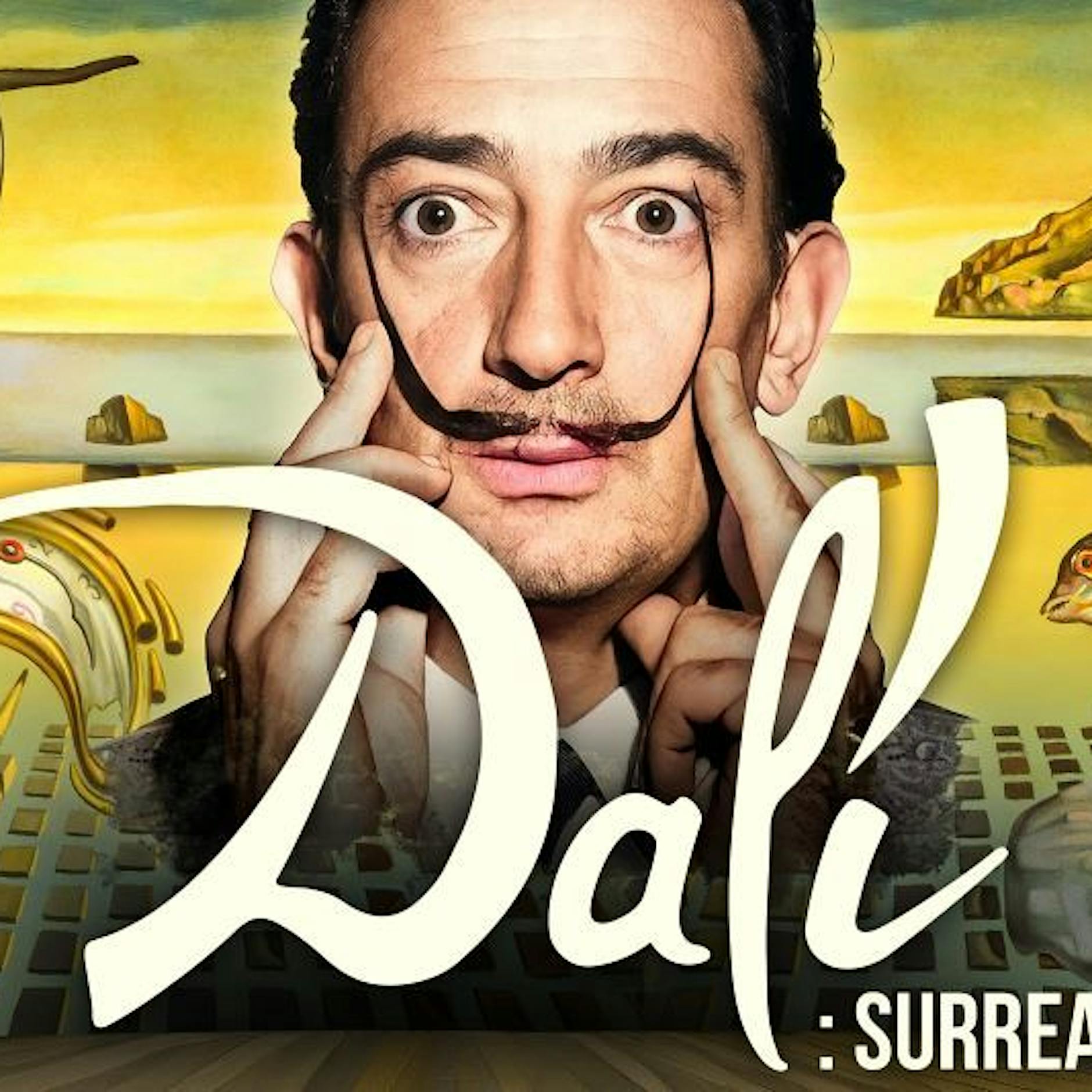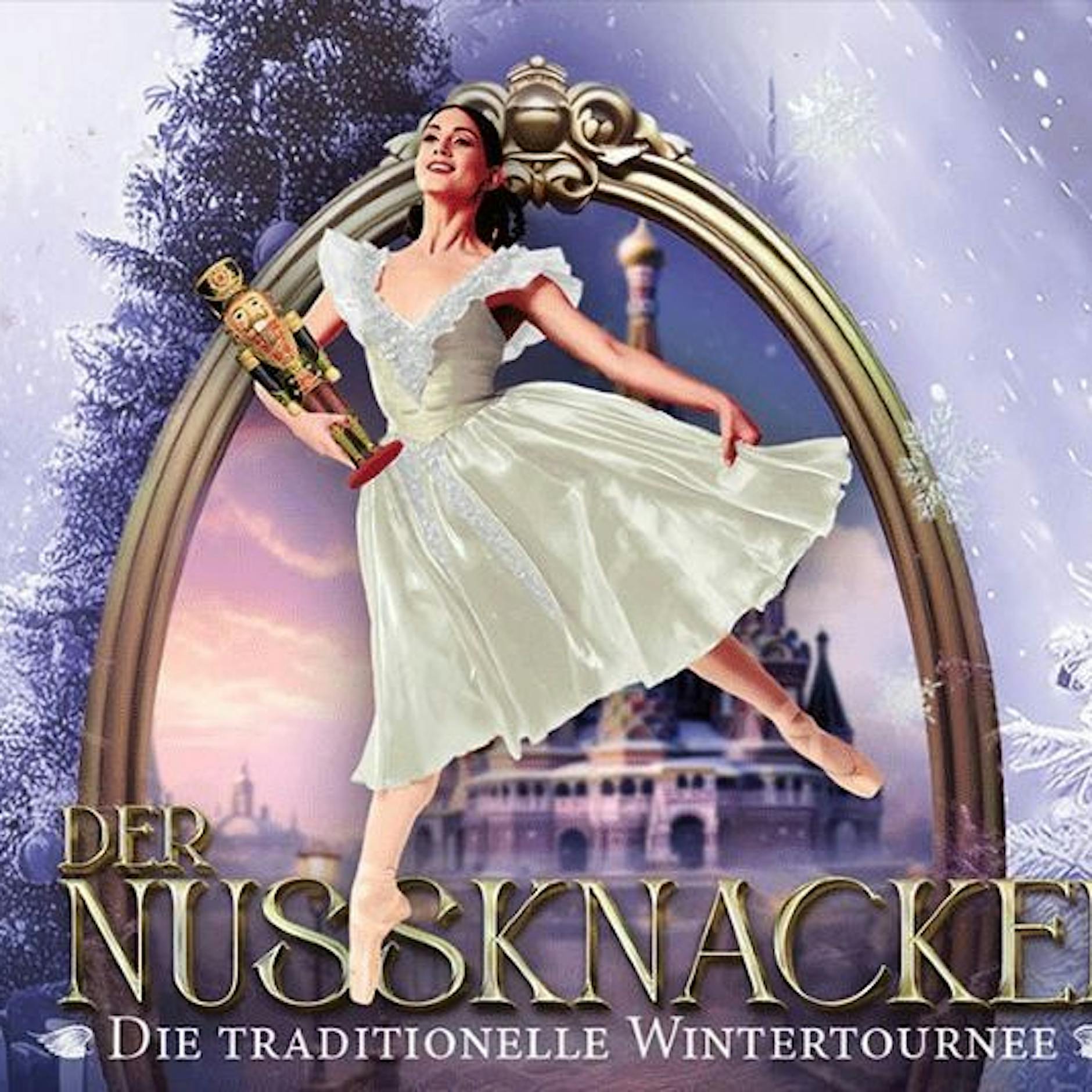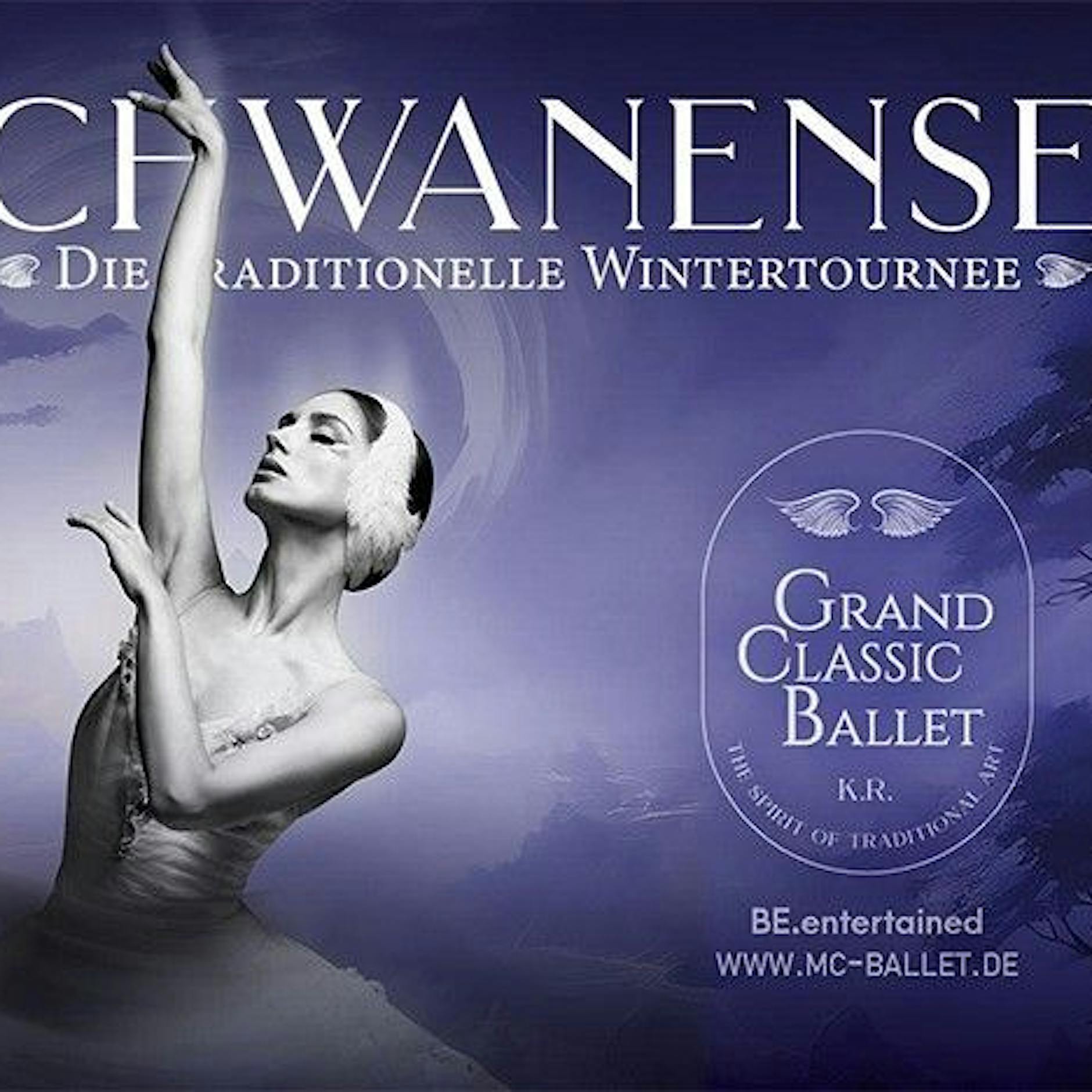Die Berliner Zeitung setzt sich für eine Aufarbeitung der Corona-Politik und eine offene Debatte ein, für eine kritische Analyse falscher und richtiger Entscheidungen während der Pandemie. Dies ist ein Gastbeitrag der Juristin Jessica Hamed.
Die über drei Jahre anhaltende Corona-Krise verblasst allmählich. Wer weiß noch, wie hoch die „Inzidenz“ gerade ist oder wie die aktuelle Sars-CoV-2 Variante heißt?
2020/21 wussten die meisten von uns, wie hoch die „Inzidenz“ ist. Und die sich gefühlt täglich ändernden Corona-Regeln bestimmten die Alltagsgespräche, so sie überhaupt stattfanden.
2020 hat eine große Mehrheit nicht laut gefragt, was ein nicht-normierter „Mund-Nasen-Schutz“ – selbstgenähte Masken oder Schals – denn epidemiologisch an Nutzen bringen soll. Und warum man im Restaurant am Platz keine Maske tragen musste, auf dem Weg zum Ausgang hingegen schon.
Der intellektuelle Shutdown einer – so dachte ich – aufgeklärten Gesellschaft. Glaube statt Evidenz.
Recht im Namen des Volkes?
Jedenfalls – unabhängig davon, ob man von einem epidemiologischen Nutzen von Masken im Alltag überzeugt ist – die Maskenpflicht im Restaurant ist aufgrund der Verbreitung des Virus durch die Luft offensichtlich vernunftswidrig gewesen.
Warum haben die Menschen diesen offensichtlichen Unsinn mitgemacht? Und warum schritten die Gerichte hiergegen nicht ein? Nicht einmal die Maskenpflicht beim Joggen hat das Verwaltungsgericht Mainz aufgehoben. Darin zeigt sich exemplarisch das Versagen des Rechtsstaats. Warum? Selbst in einem solchen Fall, in dem die Absurdität der Maßnahme zum Greifen ist, verweigerte ein deutsches Gericht den Rechtsschutz.
Über 90 Prozent der Bevölkerung befürwortete den ersten Lockdown und über 70 Prozent sprach sich im Dezember 2020 für einen „harten Lockdown“ aus. Er kam und blieb fast sechs Monate. Die Gerichte sprachen damit wortwörtlich Recht im Namen des Volkes. Auch wenn das so nicht gemeint ist.
Die Corona-Politik war zutiefst klassistisch
In weite Ferne scheinen sie gerückt, die Bilder gesperrter Parkbänke, von Polizisten bewachte Rodelhänge. Menschen, die wegen der Besuchsverbote einsam sterben mussten, denen niemand die Hand halten, einen letzten Kuss geben durfte. Kinder, die monatelang zu Hause waren, keine Schule, kein Sportverein. Häusliche Gewalt. Psychische Erkrankungen stiegen erwartbar massiv an – und ein Ende ist nicht absehbar.
Versetzen wir uns zurück in diese Zeit. Am Anfang konnte so mancher dem politisch angeordneten Stillstand eines ganzen Landes, ja, fast der ganzen Welt, etwas abgewinnen. Endlich Zeit für den Garten und die Familie.
Einigen Menschen ging es so.
Vorlesungen konnten bequem von zu Hause gehalten werden, oder es wurde ohnehin nur ein Skript hochgeladen. In einer Universität ohne Studierende lässt sich in Ruhe arbeiten, „scherzte“ so manch ein Lehrender und sonnte sich auf einer warmen Insel.
Kapitalismuskritiker:innen frohlockten, endlich einmal muss die Wirtschaft zum Schutze des Lebens zurückstehen.
Viele Unternehmerinnen und Unternehmer und deren Angestellte bangten aber um ihre wirtschaftliche Existenz.
Die Corona-Politik war zudem zutiefst klassistisch.
Die Gesellschaft hat gerade für die Schwächsten am wenigstens gesorgt
Die Lebensrealität vieler: ein monatelanger Lockdown zu viert in einer kleinen Wohnung. Es gibt einen Laptop in der Familie, mit dem Grundschulkind kann man nicht einmal auf den Spielplatz vor dem Wohnblock. Dort weht rot-weißes Absperrband. Die Nachbarn bewachen die Einhaltung des Spielverbots mit Argusaugen und sind jederzeit bereit, die Polizei zu rufen. Die Eltern streiten sich ständig, irgendwann fliegt ein Teller. Aggressionen im Fitnessstudio abbauen geht nicht. Es wird viel geschrien, die Kinder haben Angst.
Obdachlose, die wegen 3G nicht in Bahnhöfe durften, ständige Quarantäne in Unterkünften für Geflüchtete, Wegbruch der Betreuungsmöglichkeiten für Schattenkinder. Im Vergleich von 2019 mit 2021 verdoppelte sich die Zahl der Suizide in deutschen Gefängnissen.
Die Gesellschaft hat gerade für die Schwächsten am wenigstens gesorgt. Ich könnte lange mit dieser Aufzählung fortfahren. In unserem ersten Schriftsatz am 30.03.2020, mit dem wir für unsere Mandantschaft gegen den Lockdown in Hessen geklagt haben, listeten wir all die sich anbahnenden Kollateralschäden auf. In zahlreichen Klagen haben wir das immer und immer wieder gemacht. Die Verfahren sind allesamt noch in der Hauptsache anhängig.
Verkürzungen und binäres Denken beherrschten die Debatten
Der Hashtag „stayathome“ war als gut gemeinte Solidaritätsgeste ebenso zynisch wie die Isolierung der Seniorinnen und Senioren zu ihrem Schutze. Auch der Applaus aus dem Fenster für das Gesundheitspersonal fällt in diese Kategorie. Vergessen war die Solidarität mit ihnen, als sich ein nicht unerheblicher Anteil derer, die seit Jahren und Jahrzehnten das Gesundheitswesen am Laufen halten, nicht impfen lassen wollten.
EL Hotzo kommentierte im Januar 2022: „Alle Menschen, die jetzt ,impfkritisch‘ sind, waren irgendwie auch schon davor richtig nervige Arschlöcher.“
In der taz verlautbarte Udo Knapp im November 2021: „Die Impfgegner und die Impfverweigerer sind, anders als fälschlich in der Öffentlichkeit kommuniziert, keine im Grunde sympathischen, aber leider etwas verirrten Bürger, die nur falsch informiert und deshalb noch nicht über die wirklichen Zusammenhänge der Pandemie aufgeklärt sind. Nein, sie sind, wie Biermann feststellt, ,alte Schweinehunde‘, sie sind Staatsfeinde, die in voller Absicht an unseliges deutsches demokratiefeindliches Denken und Handeln anknüpfen.“
Verkürzungen und binäres Denken beherrschten die Debatten: Stefan Huster, der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Evaluation der Pandemiemaßnahmen, warf Anfang Februar 2022 die Frage auf: „Wollen wir den Lockdown, überlastete Krankenhäuser oder eine Impfpflicht?“
Die konkrete Überlastung des Gesundheitssystems drohte nicht
Die Antwort lag spätestens im Herbst 2021 auf der Hand. Die Covid-19-Impfung vermittelt keinen relevanten Fremdschutz. D.h. es blieb nur das Argument „Selbstschutz zum Fremdschutz“, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Öffnet man einmal diese Büchse der Pandora, stellt sich allerdings in Zukunft die Frage: Wo anfangen und wo aufhören?
Laut Statistischem Bundesamt ging mehr als jeder zehnte Todesfall in Deutschland 2019 auf Fettleibigkeit zurück. Besser geworden ist das seit Corona nicht. Rund zwei Drittel der Männer und gut die Hälfte der Frauen in Deutschland sind übergewichtig.
Von Rauchern und Trinkern ganz zu schweigen.
Wollen wir als Gesellschaft Menschen nach ihrer potenziellen Belastung für das Gesundheitssystem kategorisieren? Damit wäre das Solidaritätsprinzip des Gesundheitssystems faktisch aufgekündigt.
Zudem: Die konkrete Überlastung des Gesundheitssystems drohte nicht. Folglich war die Basis auch dieser Überlegung hinfällig.
Der Blick in die jüngste Vergangenheit dient nicht dem Zwecke, darüber zu lamentieren, wie schlimm alles war.
Obwohl es das war.
Es gab keine roten Linien
In meinen Augen ist ein gesamtgesellschaftliches Versagen zu konstatieren. Weder die Zivilgesellschaft noch die staatlichen Gewalten und auch nicht die vierte Gewalt haben sich als krisenfest erwiesen. Der liberale Rechtsstaat hat beim Thema Corona in Gänze versagt. Es gab keine roten Linien, die es aber – natürlich! – immer in einem Rechtsstaat geben muss. Die Justiz hätte zumindest die Exekutive dazu auffordern müssen, die Geeignetheit der Maßnahmen darzulegen, sprich die Maßnahmen zu evaluieren. Das ist bis zum Ende allenfalls in Ansätzen passiert, und so ging die staatlicherseits selbstverschuldete Unwissenheit immer zulasten der Kläger.
Wir haben außerdem die Chance verpasst, im pluralistischen und fairen Diskurs unter Anwendung der Regeln des kritischen Rationalismus um die besten Lösungen zu ringen.
Das klingt hochtrabend, aber am Ende meint es insbesondere, dass Menschen miteinander vorurteilsfrei und sachlich diskutieren. So wie man es – eigentlich – als Kind gelernt haben sollte. Man lässt einander ausreden, hört zu, und wenn man die Position des anderen nicht teilt, versucht man nicht, ihn sozial zu vernichten.
In Deutschland haben sich fast ein Viertel der Menschen nicht impfen lassen
Es gab viel zu diskutieren, denn das reine Überleben steht nicht über allem. Es ist der Abwägung zugänglich. Das ist auch nicht neu, sondern notwendiger Alltag: Wie man am banalen Beispiel des Straßenverkehrs sieht. Ganz abgesehen davon, dass „unsere“ Abschottungspolitik im globalen Süden auch Menschenleben gekostet hat.
Der Blick in die Vergangenheit soll deutlich machen, warum es einer umfassenden, wahrhaften und allen voran einer juristischen Aufarbeitung bedarf. Wir können nicht den Mantel des Schweigens darüberlegen, dass es verboten war, auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein an Menschen ohne Covid-19-Impfung zu verkaufen.
In Deutschland haben sich fast ein Viertel der Menschen nicht impfen lassen – trotz des massiven Impfdrucks. Und wie viele Menschen sich durch 2G-Regelungen, einseitige Versprechungen über die Wirksamkeit der Impfung und die sektorale Impfpflicht oder die Duldungspflicht zu einer Impfung haben drängen lassen, werden wir nie erfahren.
Wir sind richtig schlecht durch die Pandemie gekommen
Was ich aber weiß, ist, dass deutlich mehr als 25 Prozent der Bevölkerung das Vertrauen in den Staat, aber auch in die Gesellschaft ganz oder partiell verloren haben. Darunter nicht nur die Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Maßnahmen, deren Prozentsatz über dem liegen dürfte, die sich nicht haben impfen lassen, sondern auch viele, die dem Staat vertraut haben und nunmehr merken, wie viel fundamental schiefgegangen ist. Wie viele Staatsdiener der „autoritären Versuchung“, wie es Hans-Jürgen Papier, der ehemalige Bundesverfassungsgerichtspräsident, formulierte, nicht widerstehen konnten – unter dem ohrenbetäubenden Beifall nicht weniger Medienvertreter.
Um es in aller Deutlichkeit zu sagen: Wir sind nicht im Wesentlichen „ganz gut“ durch die Pandemie gekommen, mit ein paar kleinen, zu vernachlässigenden Fehlerchen.
Wir sind richtig schlecht durch die Pandemie gekommen, mit noch nicht abzuschätzenden Kollateralschäden, einer gespaltenen Gesellschaft und irreparablen, nicht erforderlichen Freiheitsverlusten.
Der Blick nach Schweden belegt das.
Die Diskussionskultur in Deutschland ist kaputtgegangen
Er zeigt übrigens auch, dass es kein politisches „Rechts-links“-Thema ist. Während dort die rechten Kräfte restriktivere Corona-Beschränkungen forderten, kritisierte die AfD hierzulande, nachdem sie zunächst zu Beginn das Gegenteil vertreten hatte, vehement den Regierungskurs.
Mir bereitet es Sorge, zu sehen, dass immer mehr Menschen in ihren „Filterblasen“ verharren und/oder sich ins Private zurückziehen.
Mir bereitet die Fundamentalopposition der „Hardcore-Kritiker“, die nichts mehr dem Staat, aber durchaus in nicht geringer Anzahl alternativen Weisheitsverkündern alles glauben, ebenso Sorgen wie die „Hardcore-Verteidiger“ der restriktivsten Maßnahmen, die immer noch glauben, Zero-Covid wäre eine vernünftige Strategie gewesen und Andersdenkende zu beschimpfen richtig.
So weit wäre es nicht gekommen, hätten wir nicht von Beginn an eine Diskursverengung erlebt, die ihresgleichen sucht.
Ich habe die Podiumsdiskussion mit Stefan Huster und mir vom 19.11.2023 im Humanistischen Salon in Nürnberg auf X (ehemals Twitter) angekündigt und wurde dort mehrfach gefragt, wie ich nur mit Herrn Huster diskutieren könnte. Man wünschte mir gute Nerven, war der Ansicht, man dürfe Herrn Huster keine Bühne geben usw. usf.
Mich entsetzt das.
Die Justiz ist ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden
Die Bemerkungen demonstrieren, wie tief die Gräben sind, und ich glaube, dass Debatten wie die zwischen Stefan Huster und mir zeigen, dass es – natürlich! – möglich ist, hart in der Sache, aber respektvoll und angemessen im Ton miteinander zu diskutieren. Eine Lehre, die wir in künftigen und aktuellen Krisen beherzigen sollten.
Unsere Diskussion kann der Anfang von einer Übung sein, die in einer offenen Gesellschaft selbstverständlich sein sollte. Ich wünsche mir, dass viele weitere derartige Debatten folgen. Für Themen der Vergangenheit, aber auch für die aktuell zu bewältigenden Krisen.
Im Humanistischen Salon haben wir u.a. über meine folgenden drei Thesen diskutiert:
1. Die Justiz ist ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Effektiver Rechtsschutz war eine Illusion.
2. Die Medien haben größtenteils ihre Kontrollfunktion nicht erfüllt und sich zu Pressesprecher:innen der Bundesregierung verzwergt.
3. Um das erlebte Group Thinking zu durchbrechen und einen offenen Diskurs zu ermöglichen, bedarf es – auch in der Justiz – der Einrichtung eines institutionalisierten advocatus diaboli.
Der Text basiert auf dem Eingangsstatement von Jessica Hamed bei einer Podiumsdiskussion des KORTIZES Instituts für populärwissenschaftlichen Diskurs mit Prof. Dr. Stefan Huster am 19.11.2023 im Humanistischen Salon Nürnberg zum Thema: „Stresstest Pandemie. Vom Einfluss der Debattenkultur in Deutschland.“
Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de
Empfehlungen aus dem BLZ-Ticketshop: