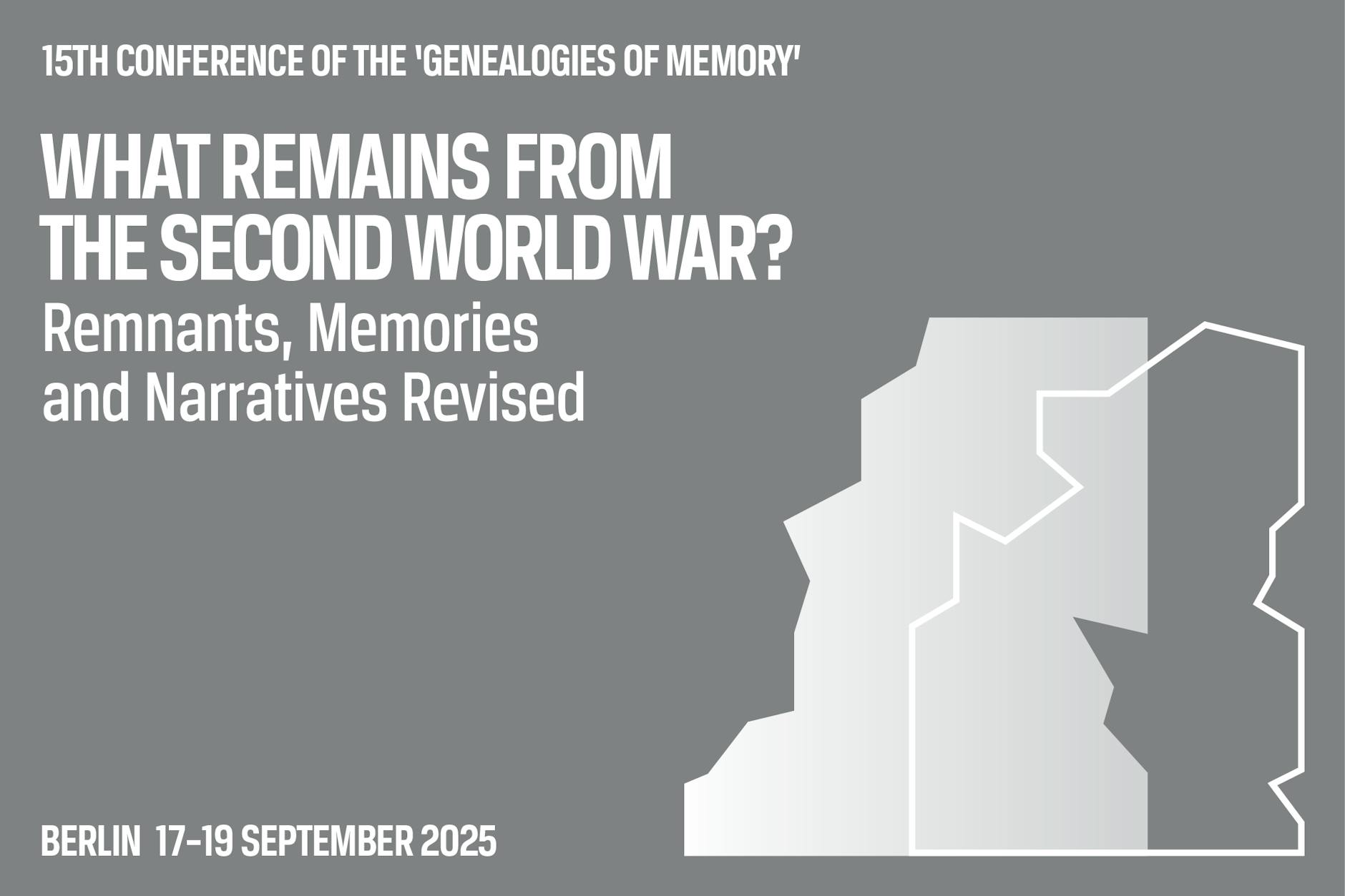80 Jahre danach: Wie das Europäische Netzwerk Erinnerung und Solidarität (ENRS) Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg mit Forschung und Bildung vernetzt
Der Zweite Weltkrieg war ein globaler Einschnitt. Rund 80 Prozent der damaligen Welt war direkt oder indirekt betroffen, über 60 Millionen Menschen verloren ihr Leben. Gleichzeitig zerstörte der Krieg moralische Tabus, beförderte Entmenschlichung und industrialisierten Massenmord, und endete mit dem Abwurf der Atombombe.
Seine Spuren sind weltweit sichtbar: ehemals verwinkelten Altstädten wurden als Hochhaussiedlungen wieder aufgebaut, Brachflächen erinnern an ausgelöschte Gebäude, Dörfer und Städte, Friedhöfe zeugen von ermordeten oder vertriebenen Bevölkerungsgruppen. Die Psyche vieler Menschen wird bis heute von den Erlebnissen ihrer Eltern und Großeltern geprägt - als Trauma, als nicht vergehende Erinnerung, die oft über Generationen nachwirkt.
Ebenso veränderte der Krieg die Erinnerungskultur. Wie viele vor ihm, wurde auch dieser Krieg in Bronze und Marmor heroisiert, aber ebenso entstanden Mahnmale und stille Interventionen, von Stolpersteinen in Aachen über Oral-History-Projekte in Bogotá bis zum Friedensdenkmal in Hiroshima.
Welche Rolle spielt die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg heute? Und wie verändert sich das kollektive Gedächtnis in Zeiten von sozialen Medien und Desinformation?
Genealogies of Memory – Konferenz über Erinnerungskulturen
Antworten auf diese Fragen sucht die Konferenz Genealogies of Memory. Vom 17. bis 19. September lädt die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften internationale Forscherinnen und Forscher ein, die historischen Ursprünge von Diskursen, Ideen und Werten kritisch zu untersuchen.
Im Fokus stehen die Weitergabe von Traumata über Generationen hinweg, die politische Instrumentalisierung von Geschichte und die Frage, welche Bedeutung Erinnerungsorte in urbanen Räumen heute haben. Den Auftakt macht die Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Warschau, Magdalena Saryusz-Wolska, mit einem Vortrag über das Gedenken an den Holocaust in Polen und Deutschland. Es folgen weitere Stimmen aus unterschiedlichen Disziplinen, von Geschichtswissenschaft über Philosophie und Psychologie bis zu Kulturwissenschaft.
Veranstalter ist das Europäische Netzwerk Erinnerung und Solidarität (ENRS), das in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Die Organisation mit Sitz in Warschau wird durch Regierungen von sechs Staaten gefördert: Deutschland, Polen, Rumänien, Slowakei, Ungarn, und seit diesem Jahr auch Tschechien und hat seit 2005 den Auftrag, die Geschichte Europas im 20. Jahrhundert zu erforschen, zu dokumentieren und zu vermitteln.
Das ENRS verbindet politische, kulturelle und wissenschaftliche Akteure wie Museen, Forschungsinstitute und Bildungseinrichtungen aus ganz Europa. Es fördert einen Dialog über eine gemeinsame europäische Erinnerungskultur, mit besonderem Blick auf die Erfahrungen von Diktatur, Krieg und Widerstand. Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes organisiert das Netzwerk eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die Ursachen, Verlauf und Folgen des Zweiten Weltkriegs beleuchten.
Der Krieg in 30 Minuten – ein Filmprojekt
Ein Teil dieses Programms ist ein 30-minütiger Dokumentarfilm, der ausschließlich auf historischem Filmmaterial basiert. Er gibt eine Übersicht über die Entwicklung an allen Fronten und erzählt die wichtigsten Ereignisse, von der „Zerschlagung der Rest-Tschechei“ durch Hitlerdeutschland am 15. März 1939 und dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 bis zur deutschen Kapitulation am 8./9. Mai 1945, dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945, und dem Beginn der Nürnberger Prozesse im November 1945.
Der Film verzichtet bewusst auf Kommentare oder Interpretationen. Zahlen und Daten sollen für sich sprechen. Der Film will keine Deutung vorgeben, sondern das Ausmaß des Krieges in kondensierter Form zeigen und so dem Publikum die Möglichkeit lassen, eigene Schlüsse zu ziehen. Mit diesem Ansatz schafft das Projekt eine Verdichtung, die kein Buch und keine Vorlesung erreichen kann. Es ist eine Einladung, die Wucht der Ereignisse zu spüren, ohne belehrenden Unterton.
Bildung gegen Desinformation
Solche Ansätze sind umso wichtiger, als sich das kollektive Gedächtnis wandelt. Was früher Teil der Familiengeschichte war, wird jetzt, da die meisten Zeitzeugen nicht mehr leben, oft von Politik und Medien bestimmt. Für die vierte Generation nach dem Krieg sind persönliche Erinnerungen kaum noch greifbar. Gleichzeitig wächst die Gefahr, dass vereinfachte Narrative und gezielte Desinformation den Ton angeben.
Deshalb hat das ENRS im Rahmen von der Lernplattform Hi-Story Lessons (hi-storylessons.eu) ein Bildungspaket für den Kampf gegen Desinformation entwickelt, mit Unterrichtseinheiten über die bekanntesten historischen Fälschungen, gegenwärtige Fälle verfälschender Berichterstattung und journalistischen Methoden zur Verifizierung von Informationen.
Hi-Story Lessons ist eine Bibliothek mit Unterrichtskonzepten, Artikeln, historischen Bildern und Übungen zu wichtigsten Themen der europäischen Geschichte. Die Zielgruppe sind Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der Mittel und Oberstufe, die unterstützt werden sollen, Quellen kritisch zu hinterfragen, Manipulationen zu erkennen und historische Fakten von tendenziösen oder politisch motivierten Narrativen zu unterscheiden. Diese Fähigkeiten sind unverzichtbar in einer Zeit, in der Fälschungen und Halbwahrheiten durch künstliche Intelligenz erzeugt und in den sozialen Medien rasant schnell verbreitet werden können.
Erinnerung als Auftrag
Erinnerung ist immer auch ein Auftrag. 80 Jahre nach Kriegsende wächst die Verantwortung, Geschichte lebendig zu erhalten und zugleich kritisch zu hinterfragen.
Die ältere Generation mag sich noch an die emotionalen Erzählungen ihrer vom Krieg gezeichneten Großeltern erinnern. Für die Jüngeren aber ist der Zweite Weltkrieg nur noch ein Kapitel im Geschichtsbuch, vielleicht nicht ganz so lang her wie die napoleonischen Kriege, aber unendlich ferner als aktuelle Konflikte von Kyiv bis Gaza. Vor diesem Hintergrund ist es bereits für deutsche Schulkinder eine Herausforderung, sich Wissen über Holocaust und die Verbrechen des Zweiten Weltkrieg anzueignen. Noch schwieriger ist es für Schülerinnen und Schüler in der Kroatien, Serbien oder der Ukraine, die sich daneben auch noch viel kürzer zurückliegendes Leiden und täglich neu entstehende Traumata erschließen müssen.