Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.
Was bedeutet eigentlich Intelligenz? Der Duden definiert sie als die „Fähigkeit [des Menschen], abstrakt und vernünftig zu denken und daraus zweckvolles Handeln abzuleiten“. Unser Gehirn sammelt und speichert Informationen, ruft sie im richtigen Moment ab, führt sie zusammen – und wenn alles gut läuft, entstehen daraus neue Erkenntnisse. Wer eine Sprache lernt, merkt sich zunächst einzelne Vokabeln und die grammatischen Regeln, die sie ordnen. Das Gehirn setzt daraus sinnvolle Sätze zusammen, sodass man Gedanken ausdrücken kann. Es wird also darauf trainiert, Informationen aufzunehmen und diese zu neuen Einsichten zu verknüpfen. In gewisser Weise funktioniert unsere natürliche Intelligenz damit ähnlich wie eine Künstliche.
Doch Intelligenz – ob künstlich oder natürlich – muss trainiert werden. Während Künstliche Intelligenz derzeit in atemberaubendem Tempo Fähigkeiten hinzugewinnt, sorgt mich weniger dieser Aufstieg als vielmehr der Abstieg unserer eigenen, natürlichen Intelligenz.
In Deutschland liest jeder fünfte Erwachsene schlecht oder sehr schlecht. Die OECD hat in ihrer Bildungsstudie (2024) die Lesekompetenz in 31 Ländern untersucht. Das Ergebnis ist ernüchternd: Der Westen wird immer dümmer. Lesen ist – neben mathematischer Logik – einer der wichtigsten Treiber und Indikatoren von Intelligenz. Bücher bestehen aus einer Abfolge von Informationen, die zusammen eine Geschichte ergeben. Um das Happy End eines Romans wirklich zu genießen, muss man erst verstanden haben und sich erinnern, was zuvor geschah – und vor allem: bis zum Ende durchgehalten haben. Doch die Aufmerksamkeitsspanne von immer mehr Menschen reicht kaum über einen Tweet hinaus. Warum ist das so?
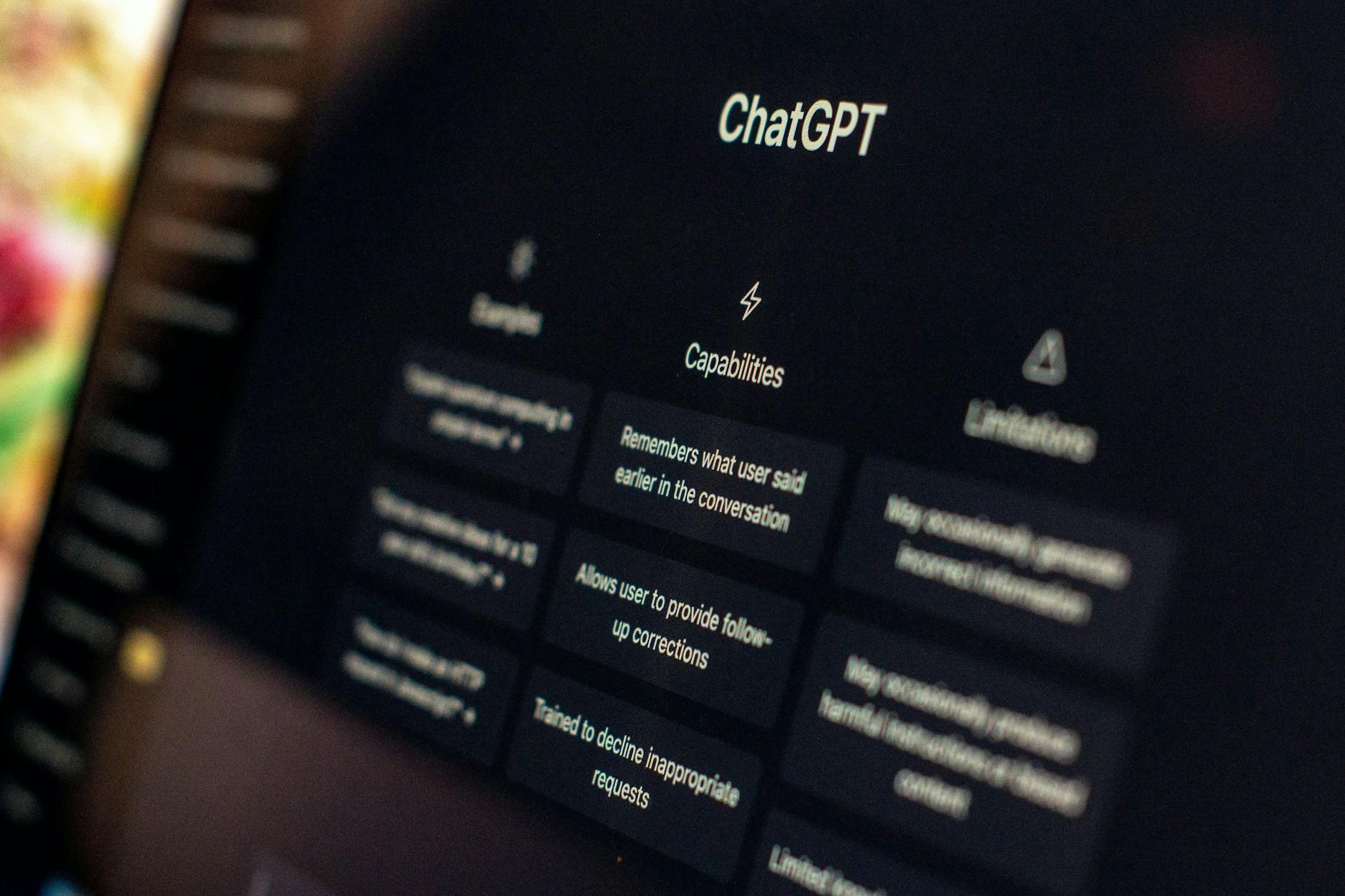
„Gehirnfäule“ auf dem Vormarsch
Nicht zufällig hat Oxford 2024 den Begriff „Brain Rot“ zum Wort des Jahres erklärt. Definiert wird er als „the supposed deterioration of a person’s mental or intellectual state, especially viewed as the result of overconsumption of material (now particularly online content) considered to be trivial or unchallenging. Also: something characterized as likely to lead to such deterioration.“ Auf Deutsch: Matsch im Kopf. Statt unser Gehirn mit sinnvollen Aufgaben zu beschäftigen, füttern wir es ununterbrochen mit zusammenhangs- und anspruchslosen Inhalten – oder, moderner gesagt, mit „Social Content“.
Erstaunlicherweise gibt es zu diesem Thema bislang relativ wenige wissenschaftliche Untersuchungen. Dystopische Prognosen über die mögliche Vernichtung der Menschheit durch Künstliche Intelligenz sind zahlreicher als Studien zum Rückgang unserer kognitiven Fähigkeiten. John Burn-Murdoch wies im März 2025 in der Financial Times auf die „Monitoring the Future“-Studie der University of Michigan hin. Diese fragt seit den 1980er-Jahren 18-Jährige, ob sie Probleme beim Denken, Konzentrieren oder Lernen neuer Dinge wahrnehmen. Während diese Fähigkeiten in den 1990er- und 2000er-Jahren stabil blieben, zeigt sich seit den 2010er-Jahren ein stetiger Abwärtstrend. Ähnliche, wenn auch später gestartete Studien, kommen zu denselben Ergebnissen.
Eine Korrelation liegt nahe: die fundamentale Veränderung unseres Umgangs mit Informationen. Internet und Smartphone haben Wissen jederzeit und überall verfügbar gemacht. Anfangs waren Online-Texte noch vergleichsweise lang, doch mit dem Aufstieg der sozialen Medien wurde das verdrängt. Ich erinnere mich gut daran, wie sich auch soziale Situationen dadurch plötzlich verändert haben – und wie mein eigenes Denken sich wandelte. Diskussionen über abstrakte Themen endeten auf einmal schnell mit: „Google doch einfach.“
Noch heute wird in vielen Gesprächen jemand sein Smartphone zücken, die gesuchte Information präsentieren und damit der Magie des Gesprächs jede Tiefe nehmen. Denken wird zur zweitklassigen Tätigkeit degradiert. Informationen „auszulagern“ ersetzt die geistige Auseinandersetzung. Das wirkt nicht nur als Killer der Denkleistung, sondern auch als sozialer Killer.

KI ist ein Hilfsmittel, kein zweites Gehirn
Die gesellschaftlichen Folgen sind bereits sichtbar. Der Aufstieg politischer Ränder, links wie rechts, hängt auch damit zusammen, dass viele Menschen Zusammenhänge nicht mehr erfassen. Sie glauben zwar, gut informiert zu sein, bewegen sich aber tatsächlich nur im „Brain Rot“. Wenn man nicht trainiert ist, Informationen im größeren Kontext zu verarbeiten, ist es leicht, einer Heidi Reichinnek zuzustimmen, auf dem Weg ins Paradies müsse man nur endlich alle Milliardäre enteignen. Oder Alice Weidel zu glauben, alle Probleme ließen sich lösen, wenn man die Grenzen schließe.
Die liberalen Kräfte unseres Landes konzentrieren sich hauptsächlich auf ihr Marketing und übersehen, dass leere Sprachhülsen ohne intellektuellen Unterbau niemanden überzeugen. Wo mehr Schein als Sein gilt, erscheinen selbsternannte Twitter-Philosophen plötzlich näher als die eigenen Vordenker.
Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.
Unsere Gesellschaft ist derart fixiert darauf, in die Glaskugel zu blicken, was Künstliche Intelligenz leisten könnte – vom neuen Wirtschaftswunder über die Auslöschung der Menschheit bis hin zur nächsten Blase. Dabei übersehen wir, was unsere eigene natürliche Intelligenz längst nicht mehr leistet. Genau das ist das eigentliche Problem. Wir müssen Künstliche Intelligenz als das begreifen, was sie ist: ein Hilfsmittel, kein zweites Gehirn.


