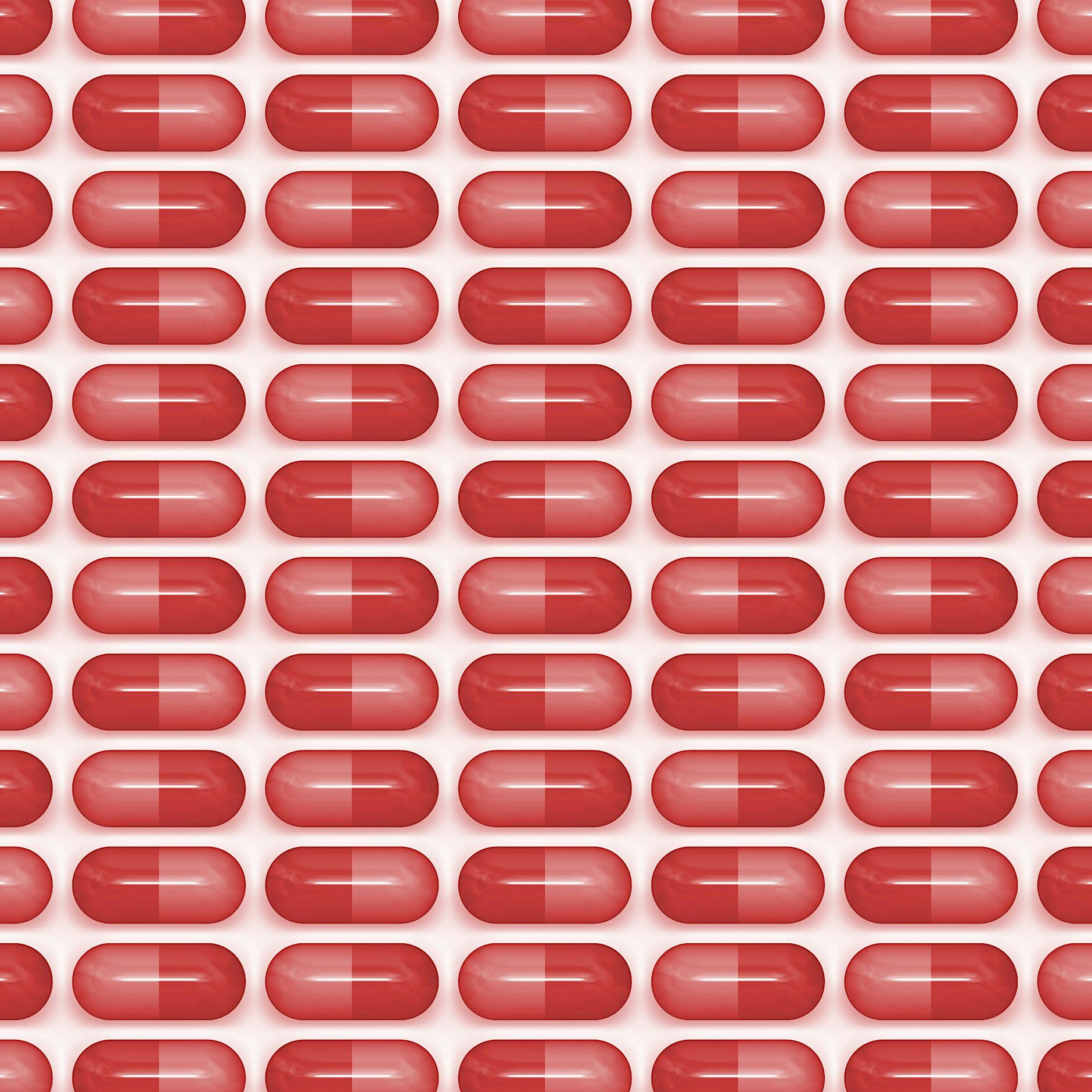Sie sind eine wachsende Bedrohung. Ihre Namen lauten Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus oder Escherichia coli. Gemeint sind multirestistente Keime, also Krankheitserreger, die auf immer weniger Antibiotika reagieren. Mitunter auch auf gar keine mehr, dann werden sie als „panresistent“ bezeichnet.
Mehr als 35.000 Menschen sterben jährlich in Europa aufgrund von Antibiotikaresistenzen, so schätzt die EU-Gesundheitsbehörde ECDC. Infektionen mit resistenten Krankheitserregern sind eine der häufigsten Todesursachen auf Intensivstationen. Forscher suchen intensiv nach neuen Antibiotika, die gegen viele Bakterien wirken und bei denen sich nicht so schnell Resistenzen entwickeln können.
Nun kommt eine hoffnungsvolle Nachricht aus Berlin. Wissenschaftler der Technischen Universität (TU) Berlin haben ein mögliches neues Antibiotikum entdeckt: und zwar das natürliche Pflanzengift Albicidin. Dieses wird von einem bestimmten Bakterium namens Xanthomonas albilineans produziert, das vor allem in den Tropen und Subtropen vorkommt. Dort befällt es vor allem Zuckerrohr und löst die Blattbrand-Krankheit aus, die ganze Ernten vernichten kann. Mitunter richtet es auch Schäden an Mais-Kulturen an.
Gift schädigt bei der Zellteilung die DNA und vernichtet die Pflanzen
Das Bakterium bildet das Gift Albicidin, um die Pflanze anzugreifen, diese als Wirtsorganismus zu nutzen und sich weiter auszubreiten. Die chemische Struktur des Gifts konnte bereits 2015 aufgeschlüsselt werden, und zwar von einer Forschergruppe um den Biochemiker Roderich Süssmuth vom Fachgebiet Organische und Biologische Chemie der TU Berlin zusammen mit französischen Wissenschaftlern.
Inzwischen ist es den TU-Forschern in Kooperation mit Wissenschaftlern aus Großbritannien und Polen gelungen, das Pflanzengift so zu verändern, dass es gegen multiresistente Krankenhauskeime eingesetzt werden kann. Die Ergebnisse wurden jetzt in der Fachzeitschrift Nature Catalysis publiziert.
Zunächst wollten die Forscher jedoch genau wissen, wie das Gift wirkt. Der Prozess ist für Laien recht kompliziert zu verstehen. Das Pflanzengift Albicidin greift nämlich ein bestimmtes Enzym der Pflanzen an. Enzyme sind komplexe Moleküle, die bei biochemischen Prozessen in Organismen als Katalysatoren dienen.
Das Enzym namens Gyrase zum Beispiel spielt eine Rolle bei der Zellteilung der Pflanzen. Hierbei muss das Erbgut der Zelle – die DNA –vollständig kopiert werden. Das Enzym Gyrase dockt an die DNA an und sorgt dafür, dass dabei keine schwerwiegenden Fehler entstehen. Daran wird es jedoch vom Pflanzengift Albicidin gehindert. Es kommt zur Schädigung der DNA und zum Tod der Zelle.
Neues Mittel könnte auch gegen gefährliche „Superbugs“ wirken
Auf diese Weise nützt das Gift Albicidin aber nicht nur dem Zuckerrohr-Schädling bei seiner Vernichtungsarbeit. Denn das Enzym Gyrase kommt auch bei anderen Organismen vor – speziell bei Bakterien. Also könnte man das Gift auch gegen Bakterien einsetzen, die Krankheiten beim Menschen verursachen, dachten sich die Forscher.
Auf die Frage, ob man dabei nicht auch dem Menschen selbst schaden könnte, heißt es in der Mitteilung der TU Berlin: Beim Menschen gebe es zwar verwandte Enzyme, „die Unterschiede zur Gyrase sind aber hinreichend groß, sodass Albicidin uns mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts anhaben kann“. Dies hätten auch vorklinische Studien ergeben. Allerdings muss so etwas später in klinischen Studien auch gründlich bestätigt und mit Daten belegt werden. Erfahrungsgemäß haben Antibiotika mitunter heftige Nebenwirkungen.
In Vorstudien zeigte sich auch das große Potenzial von Albicidin. Es sei einer der wichtigsten Kandidaten für ein neues Breitbandantibiotikum, das dringend gebraucht werde, heißt es aus der TU. Also für ein Antibiotikum, das gegen eine Vielzahl an Krankheitserregern wirkt. Denn immer mehr Bakterien werden gegen bisherige Breitbandantibiotika resistent. Solche Resistenzen entstehen vor allem dann, wenn Antibiotika zu häufig, unnötigerweise oder nicht genau nach ärztlichen Vorgaben angewendet werden.
Albicidin unterscheide sich aufgrund seiner Wirkweise so sehr von bestehenden Antibiotika, dass es „wahrscheinlich gegen die meisten der derzeitigen antibiotikaresistenten Bakterien, die sogenannten Superbugs“ wirksam werden könnte, so lautet die Hoffnung der TU Berlin.
Forscher beobachten das Gift Albicidin „bei der Arbeit“
Bevor man Albicidin jedoch als Breitbandantibiotikum einsetzen kann, muss noch einiges geschehen. Es sei notwendig, „die Struktur und Zusammensetzung des doch recht großen Albicidin-Moleküls für seine Verwendung als Arzneimittel zu optimieren“, sagt der TU-Forscher Roderich Süssmuth. „In der Chemie sprechen wir hierbei von einem ‚rationalen Design‘ des Moleküls.“
Zum Beispiel wollten die Forscher ganz genau wissen, wie Albicidin mit dem Enzym Gyrase seiner Opfer interagiert. Um das Gift sozusagen „bei der Arbeit“ zu beobachten, taten sich die TU-Forscher mit zwei anderen Laborteams zusammen: dem von Dmitry Ghilarov am John Innes Centre im englischen Norwich und dem von Jonathan Heddle an der polnischen Jagiellonen-Universität in Krakau.
Sie nutzten die Methode der Kryo-Elektronenmikroskopie. Hier werden Elektronenstrahlen bei tiefen Temperaturen von unter minus 150 Grad Celsius eingesetzt. Auf diese Weise werde es möglich, Vorgänge auf molekularer Ebene ohne Verwacklungen in Tausenden von Schnappschüssen festzuhalten, so die TU Berlin.
Extrem hohe Wirksamkeit in kleinen Konzentrationen
„Das Ergebnis: Albicidin bildet eine Art L-Form und kann so auf einzigartige Weise sowohl mit der Gyrase als auch mit der DNA interagieren“, heißt es zur Erklärung. In diesem Zustand könne die Gyrase nicht mehr tätig werden, um für eine sichere Kopie der DNA bei der Zellteilung zu sorgen. „Die Wirkung von Albicidin ähnelt hier einem Schraubenschlüssel, der zwischen zwei laufende Zahnräder geworfen wird und diese blockiert.“
Nachdem die Forscher diese Wirkungsweise erkannt hatten, konnten sie am Computer und im Labor Varianten des ursprünglichen Albicidin-Moleküls kreieren, die gegen einige der gefährlichsten bakteriellen Infektionen im Krankenhaus wirksam sind.
„Wir glauben, dass dies einer der aufregendsten neuen Antibiotika-Kandidaten seit vielen Jahren ist“, erklärt der Molekularbiologe Dmitry Ghilarov aus Norwich auf dem Portal bionity.com. „Es hat eine extrem hohe Wirksamkeit in kleinen Konzentrationen und ist hoch wirksam gegen pathogene Bakterien – sogar gegen solche, die gegen die weit verbreiteten Antibiotika wie Fluorchinolone resistent sind.“
Es scheine, „dass Albicidin aufgrund der Art der Wechselwirkung auf einen wirklich wesentlichen Teil des Enzyms abzielt und es für Bakterien schwierig wäre, dagegen eine Resistenz zu entwickeln“, sagt Roderich Süssmuth. Der Wirkstoff soll aber weiter verbessert werden.
Neue Klasse von Antibiotika könnte Tausende Menschen retten
Die bereits chemisch synthetisierten Varianten des Antibiotikums hätten sich in Tests bereits als wirksam erwiesen „gegen einige der gefährlichsten bakteriellen Infektionen im Krankenhaus, darunter Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa und Salmonella typhimurium“, heißt es aus der TU.
Die erwähnten Bakterien lösen unter anderem schwere Darm-, Wund- und Harnwegsinfektionen aus, sowie Lungenentzündungen und Bakteriämien bis hin zur Sepsis, die oft tödlich verläuft. Der Wirkstoff Albicidin sei gegen sie „bereits in kleinen Konzentrationen hoch wirksam“ gewesen.
Im nächsten Schritt wollen die Wissenschaftler mit weiteren akademischen und industriellen Partnern zusammenarbeiten. Sie suchen nach Geldgebern, „um die Forschung zu klinischen Studien am Menschen voranzubringen“, erklärt Roderich Süssmuth. „Sind diese erfolgreich, würde Albicidin eine ganz neue Klasse von Antibiotika begründen – und könnte vielen Tausenden von Menschen jährlich das Leben retten.“
Empfehlungen aus dem Ticketshop: