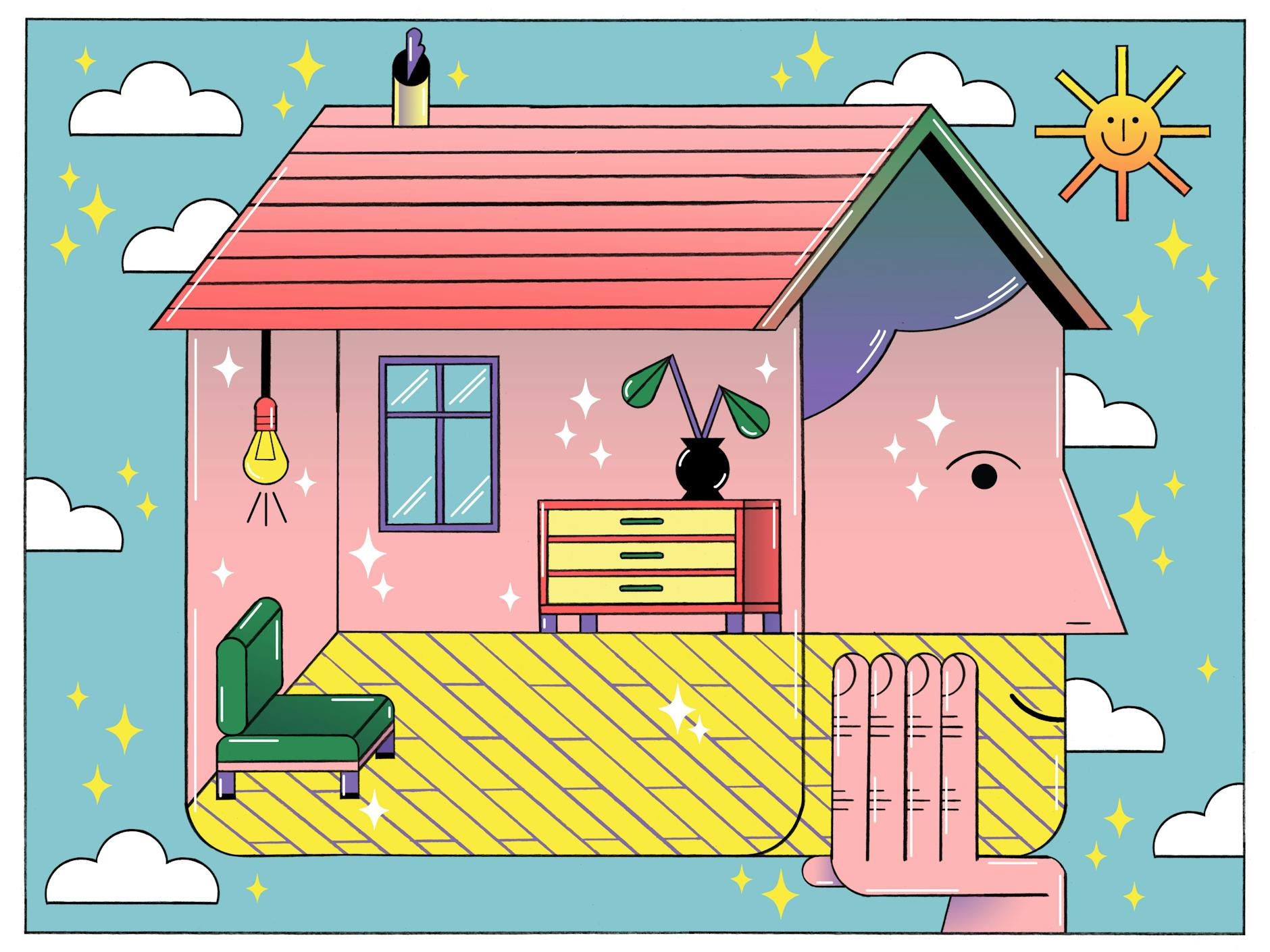„Wer bin ich, wenn ich bin, was ich habe, und dann verliere, was ich habe?“ fragte Erich Fromm in seinem Buch „Haben oder Sein“ aus dem Jahr 1976. Schon vor bald einem halben Jahrhundert kritisierte der Sozialpsychologe das Konsumverhalten in der Überflussgesellschaft. In Zeiten von Ressourcenknappheit und Klimawandel passt Fromms gesellschaftskritisches Werk gut ins 21. Jahrhundert. Das findet auch Martin, der sich seit einigen Jahren einmal im Monat mit Gleichgesinnten beim Minimalismus-Stammtisch im Prenzlauer Berg austauscht. Das Gros der Teilnehmer ist zwischen 30 und 40 Jahre alt. Gesprochen wird über persönliche Erfahrungen und Themen wie Abfallvermeidung oder Tiny Houses. Wie auch die meisten anderen Minimalisten möchte Martin nur mit seinem Vornamen genannt werden.
Martin ist 38, trägt Brille, Bart und ungebändigte Wuschelhaare, und er ist schon mehr als sein halbes Leben lang Minimalist. „Eigentlich schon, bevor es den Begriff überhaupt gab“, sagt er. „Haben oder Sein“ hat er während des Zivildienstes gelesen und die Abschlussarbeit seines Philosophiestudiums über Minimalismus geschrieben. Inzwischen lehrt er an der Universität Rostock. Das Thema seines Seminars: die Philosophie des Verzichts. Der Mann, der schon früh sein Denken beeinflusst hat, lebte vor mehr als 2400 Jahren: Diogenes von Sinope, besser bekannt als Diogenes in der Tonne, ein radikaler Verfechter der Selbstgenügsamkeit. Nur der sei richtig glücklich, so dessen Lehre, der frei sei von überflüssigen Bedürfnissen und unabhängig von äußeren Zwängen.
Minimalistisch leben bedeutet Wohnfläche zu reduzieren
So weit wie sein antikes Vorbild geht Martin zwar nicht, er lebt aber „sehr reduziert“. Während dem Deutschen durchschnittlich 47,4 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung stehen, begnügt er sich mit 36,5 Quadratmetern. Zum Reisen braucht Martin kein rollendes Haus in LKW-Größe. Stattdessen hat er sich mit seiner Freundin einen Kleinwagen zum „Wohnmobil“ umgebaut. Gemeinsam besucht das Paar Workshops zum Thema Nachhaltigkeit und Food Sharing.
Olivera, die vor sieben Jahren den Minimalismus-Stammtisch ins Leben gerufen hat, beschäftigt sich bereits seit neun Jahren mit dem Thema. Damals zog die heute 38-Jährige mit ihrem Freund in eine 75-Quadratmeter-Wohnung in Friedrichshain, wo die mittlerweile fünfköpfige Familie – die drei Kinder sind zwischen zwei und acht Jahre alt – immer noch lebt. Dank ihrer Lebensweise kommt sie mit der Wohnfläche gut klar. „Doch in der Corona-Zeit wären ein, zwei Zimmer mehr schon schön gewesen“, gibt Olivera zu.
Aber es geht auch so. Kreative Lösungen müssen her, etwa bei der Raumteilung. Das sogenannte Rotationsprinzip hilft beim Ordnunghalten im Kinderzimmer – demnach steht den Kindern immer nur ein Teil ihrer Spielsachen zur Verfügung. Großkampftage sind Weihnachten oder Geburtstage. Zwar halten sich Freunde und Verwandte mit Geschenken weitgehend zurück. Doch es gebe immer Menschen, „die es gut mit den Kindern meinen“, klagt Olivera. Immer wieder staunt sie, welch nutzlose und minderwertige Dinge für Kinder produziert würden; vieles gehe schnell kaputt oder lande unangetastet in der Ecke.
Viel mehr Erfüllung fänden die Kinder draußen beim Spiel in der Natur. „Sie hinterfragen vieles und begreifen auch schon die Zusammenhänge“, freut sich Olivera, die in der Öffentlichkeitsarbeit tätig ist. Man könne mit den Kleinen erstaunlich gut reden. Luxus sei keine Anhäufung von Dingen, sondern etwa die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit zu reduzieren und dafür mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. „Mehr Platz schafft mehr Energie“, findet sie. Auch bei der Kleidung pflegt Olivera einen minimalistischen Stil. Sie trägt überwiegend Schwarz. So sei alles mit allem kombinierbar, sagt sie, und die Schubladen würden nicht überquellen.
Katharina ist mit Ende 50 die Älteste der zwei Dutzend Stammtischteilnehmer. Sie ist Übersetzerin für Kinder- und Jugendliteratur und seit drei Jahren bei den Treffen dabei, „die extrem meinen Horizont erweitert haben.“ Inzwischen ist sie Vegetarierin geworden, und sie hat die Freuden des Ausmistens entdeckt, die sie am liebsten mit Freunden und Verwandten teilen würde. Zu ihrer Enttäuschung musste sie aber feststellen: „Viele jammern, dass sie zu viele Sachen haben, wollen aber nichts ändern.“
„Viele fühlen sich von ihren Dingen oder auch von ihrem Papierkram erschlagen, schaffen es aber nicht, das Thema anzugehen“, findet auch Corinna Rose, Ordnungscoach des Minimalismus-Stammtisches vom Prenzlauer Berg. Nach dem Tod ihres Vaters half sie ihrer Mutter, von einer Fünfzimmerwohnung in eine Einzimmerwohnung umzuziehen. Das Ausmisten brachte viel in Gang. Sie fragte sich: „Was bleibt von einem Leben übrig? Was ist die Essenz?“ Und sagte dem Gerümpel des Alltags den Kampf an. Seitdem ist viel in Bewegung gekommen. Corinna Rose ist gelernte Bibliothekarin. Einige Jahre arbeitete sie nebenberuflich als Ordnungscoach, seit 2021 tut sie es in Vollzeit – und sie hat gut zu tun, denn das Thema treibt viele um. Einige ihrer Klienten wünschen sich eine bessere Struktur, andere klagen über komplett zugestellte Wohnungen.

Das Loslassen von Dingen fällt vielen schwer
Das Loslassen von Dingen fällt vielen schwer, denn diese sind verknüpft mit Erinnerungen und Emotionen. Doch die übergroße Fülle an Materiellem ist nicht nur ein individuelles, sondern auch ein gesellschaftliches Problem. Die Menschen wollen immer mehr immer schneller haben. Der Psychologe Werner Gross sucht hierfür nach Erklärungen. Zum einen sei das Angebot da. Auf dem Markt herrsche eine Art „pervertierte Kundenorientierung“. Der Kunde wiederum verhalte sich kindlich narzisstisch. Er sei überzeugt, dass er ein Recht darauf habe, seine sehr hohen Ansprüche erfüllt zu bekommen. Dabei werde seine Frustrationstoleranz immer niedriger. Unter dem Motto: „Ich will alles sofort und in hoher Qualität mit möglichst wenig Aufwand!“
Die Konsumgesellschaft ermutige diese Haltung noch. Ihre Werbestrategie bestünde darin, Menschen dazu zu bringen, Sachen zu kaufen, die sie gar nicht brauchten. Das habe der Kapitalismuskritiker Karl Marx bereits vor anderthalb Jahrhunderten erkannt. In all dem Überfluss fällt es vielen Menschen schwer, zwischen Wichtigem und Unwichtigem zu unterscheiden – mit weitreichenden Folgen für ihr Leben. „Schätzungen zufolge leiden allein in Deutschland etwa 2,5 Millionen Menschen unter dem Messie-Syndrom“, berichtet Gross, Experte für sogenannte stoffungebundene Suchtformen. Messies sammelten zwanghaft Dinge, was dazu führen könne, dass sie es nicht mehr schaffen, ihr Leben zu organisieren. Im Extremfall komme es zur Verwahrlosung. Werner Gross macht die Wahllosigkeit, mit der bisweilen „gesammelt“ wird, betroffen. Er erinnert sich an eine Patientin, die 40.000 leere Joghurtbecher hortete.
Die vermüllte Wohnung wird dann zum Rückzugsort, zur Trutzburg, in die niemand mehr eindringen darf. Aber auch in weniger schweren Fällen zeigt sich das innere Chaos der Betroffenen nach Außen. Messies verwechseln Sein mit Haben; mit Quantität wird versucht, eine innere Leere zu füllen.
„Wir Minimalisten wollen uns nicht mit Dingen belohnen“, erklärt Corinna Rose. Inspiriert von der prominenten japanischen Aufräum-Meisterin Marie Kondo, genießt sie die Freiheit, mit weniger Dingen zu leben. „Man muss weniger putzen, braucht weniger Geld und hat mehr Platz.“ Mit ihrem Mann konnte sie so inzwischen in eine kleinere Wohnung umziehen. Gelegentlich stößt sie auf Unverständnis und hört Sprüche wie: „Warum willst du deine Arbeitszeit reduzieren? Du hast doch keine Kinder!“
Weniger Besitz, dafür mehr Zeit
Seitdem Joachim Klöckner vor bald einem Vierteljahrhundert seinen Besitzstand radikal reduziert hat, hat er ein anderes kostbares Gut zurückgewonnen: Zeit. „Gegenstände erfordern viel Kraft“, ist seine Erfahrung. „Einmal dafür, das Geld für den Erwerb zu erarbeiten. Dann das Geld für den Raum, den sie okkupieren, und Zeit und Energie für die Pflege. Und dann nochmals Geld und Energie, um sie wieder zu entsorgen“. Während der Durchschnittsdeutsche laut statistischem Bundesamt rund 10.000 Dinge besitzt, begnügt sich Klöckner, Autor des Buches „Der kleine Minimalist“, mit 50. Dazu gehört sein Tablet und sein Smartphone – seine Verbindungen zur Welt.
Die Fragen, die er sich immer wieder stellt, lauten: „Was brauche ich wirklich an materiellen Dingen für mein Leben? Was trägt tatsächlich zu meinem Wohlbefinden bei?“ Minimalismus ist für ihn eine Möglichkeit, „Freiheit zu spüren, sein Leben aktiv zu gestalten, und zwar sowohl zum eigenen Wohl als auch dem der Mitwelt.“ Ein Leben mit wenigen Dingen heißt für ihn, sich für das Wesentliche zu entscheiden.
Doch so ein unbeschwertes Leben musste er erst lernen. In jungen Jahren arbeitete der gelernte Maschinenbauer und spätere Energieberater häufig 80 Stunden die Woche. Vom Sekundenschlaf bei 140 Stundenkilometern erwachte er erst, als das Auto gegen die Leitplanke krachte. Das Leben drehte sich immer schneller, mehr als 100.000 Kilometer legte er manchmal pro Jahr zurück. Schließlich entwickelte sich sogar ein Hobby daraus: Motorsport. Von den mehr als 100 Pokalen, die er damals gewann, besitzt er keinen einzigen mehr.
Seine ganze Habe passt heute in einen Rucksack. Seine Kleidung in weniger als eine halbe Waschmaschine. Als Mantel für kühle Tage dient ihm eine als Poncho umfunktionierte Wolldecke. Wenn ihm Jugendliche auf der Straße hinterherrufen „Hey Moses“, bleibt er cool. Seine Botschaft: „Nimm dein Leben in die Hand“ und „Sei du selbst“. Fällt das Überflüssige weg, bleibt die Essenz. Aber nicht alles ist so einfach in seinem materiell reduzierten Leben. Der 73-Jährige, der sich seine schmale Rente mit Vorträgen aufbessert, kann sich sein altes, nur mit einer Hängematte möbliertes Zimmer in Berlin nicht mehr leisten. Derzeit hat er bei einer Freundin in der Nähe von Bonn Unterschlupf gefunden.
Wie weit kann man gehen als Minimalist? Kann man wirklich auf fast alles verzichten? Wo ist die Grenze? Was zunächst wie eine Befreiung wirkt, kann durchaus ins Zwanghafte abdriften. Hinter den besten Absichten könne sich eine süchtige Grundstruktur verbergen, sagt der Suchtpsychologe Gross.
Was halten die Stammtischbesucher von Menschen, die ganz aussteigen wollen aus dem System und etwa als Einsiedler im Wald und ohne Krankenversicherung leben wollen? „Es ist wichtig, Verantwortung zu übernehmen, auch für die eigene Gesundheit. Da gehört eine Krankenversicherung einfach dazu“, lautet ihre einhellige Meinung. Mara findet: „Wir sind Teil der Gesellschaft. Krankenversichert zu sein, ist auch ein solidarischer Akt.“ Für die meisten gibt es eine „Wohlfühlgrenze“. Ausschlusskriterien für den Besuch des Stammtisches gibt es nicht. Menschen mit sehr krassen Einstellungen seien aber eher die Ausnahme.
Der Austausch beim Stammtisch sensibilisiert die Teilnehmer auch politisch. Sie wollen Verantwortung nicht nur für das eigene Leben übernehmen, sondern auch der Umwelt gegenüber. Weg vom rein Individuellen und hin zum Solidarischen. Auf der Tagesordnung stehen Themen wie Nachhaltigkeit, Zero Waste, Foodsharing oder Tauschen.
Den Wunsch, einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, findet Gross sehr positiv. Problematisch würde es jedoch, „wenn die Befreiung vom Konsumterror umschlägt in den Terror des Ich-Ideals, mit unheimlich hohem Anspruch.“ Alarmzeichen sind für ihn neben Kasteiung und Selbstquälerei missionarische Botschaften im Stil von: Ihr müsst euch genauso vorbildlich verhalten wie ich. Gutes Leben ist für Werner Gross aber nicht nur sinnhaft, sondern auch sinnlich. Es gelte, die Balance zu wahren. Alleine die Welt retten zu wollen, sei auch ein Stück Größenwahn.
Die Mitglieder des Minimalismus-Stammtisches sind allerdings nicht in Gefahr abzuheben. Statt großer Träume leben sie kleine Utopien, beschäftigen sich mit Konzepten, wie es sich auf engem Raum leben lässt. Sie stellen sich Fragen wie: Warum muss jeder seine eigene Waschmaschine haben? Einige träumen von alternativen Wohnprojekten.
Für die 36-jährige Mara ist es ein Prozess. Sie hat eigentlich schon immer minimalistisch gelebt. Geholfen hat ihr dabei, dass sie inzwischen schon 16 Mal umgezogen ist. „Da war ich automatisch gezwungen, viel auszusortieren.“ Ein bestimmtes Ziel hat sie nicht, und sie setzt sich auch nicht unter Druck. Heilige sind Minimalisten nicht. Neulich kam Katharina aus Zeitmangel mit einem Coffee-to-go-Becher zum Stammtisch und hatte ein furchtbar schlechtes Gewissen. Zu ihrer Erleichterung stellte sie fest, dass sie nicht die Einzige war.
„Der Mensch der Zukunft ist ein Minimalist“, glaubt Martin, „nicht, weil er es will, sondern, weil er es muss.“ Derzeit lebten die Menschen über ihre Verhältnisse. „Wenn sich nichts ändert und die Temperaturen weiter steigen, werden wir schon 2050 in einer skurrilen Welt leben“, befürchten die Minimalisten.
Noch gäbe es zu wenig positive Initiativen, wie etwa Carsharing. Auch sind nicht alle Minimalisten Idealisten. Es gibt auch die Elitären, für die es Lifestyle ist, sich nur mit dem Exquisiten und Hochpreisigen zu begnügen. Und das muss man sich leisten können. „Klappräder, die man super klein zusammenfalten kann, sind oft die teuersten“, sagt Martin selbstkritisch. „Und weniger zu arbeiten, können sich häufig nur die Besserverdienenden erlauben.“