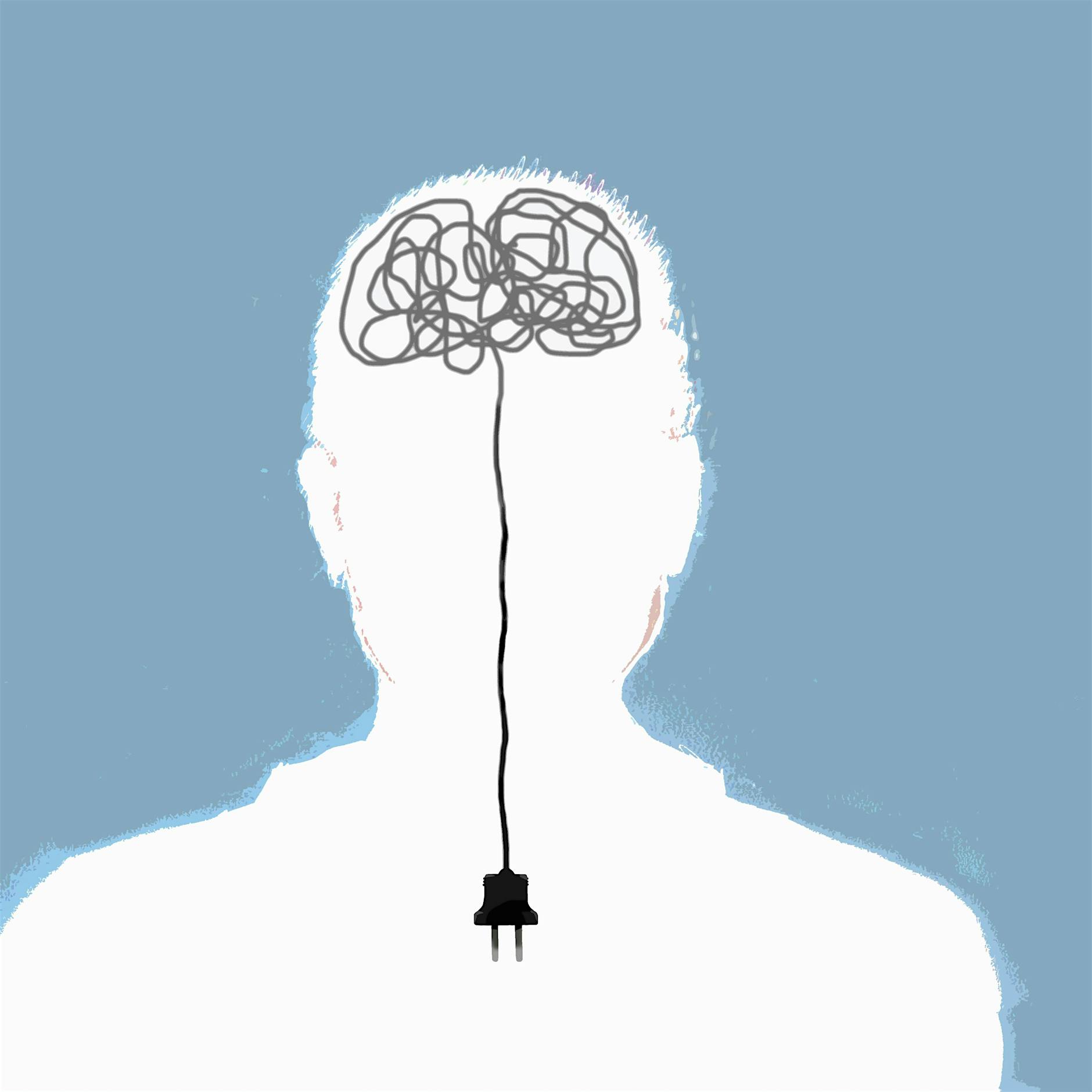Berlin- „Schlampe“, „Schwuchtel“, „Hurensohn“: Hasser benutzen gerne diskriminierende Begriffe, um Verachtung und Ekel auszudrücken und Personen zu entwerten, erklärt Psychotherapeutin Hildegard Stienen – dadurch werde das eigene Selbsterleben gestärkt. Ein Gespräch über den Drang, andere zu beleidigen, die männliche Vormachtstellung, Auswirkungen von Likes und Emoticons in den sozialen Medien und die Frage, ob Hasskommentare ignoriert werden sollten.
Berliner Zeitung: Frau Stienen, woher kommt der Drang, andere zu beleidigen?
Hildegard Stienen: Es gibt Grundgefühle, die uns angeboren sind. Angst ist ein sehr dominantes Gefühl und auch für Aggressivität und Wut haben wir Anlagen. Letztere Gefühle helfen uns durchzusetzen, uns gegen Ungerechtigkeiten zu wehren oder Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erreichen. Von Aggressivität gibt es eine abgeleitete und erlernte Form: den Hass. Wir kommen nicht mit Hass auf die Welt, aber es gibt Menschen, die aufgrund bestimmter Persönlichkeitsmerkmale oder negativer Erfahrungen Hassgefühle entwickeln. Diese können sich in Form von Beleidigungen entladen, mit dem Ziel, andere Menschen zu verletzen.
Gibt es auch gesellschaftliche Formen, die befördern, dass Menschen draufloshassen?
In einer demokratischen Gesellschaft ist durch die Meinungsfreiheit viel abgedeckt, aber die Grenze zur Hassrede ist klar gezogen. Trotzdem gibt es auch hier autoritäre Strömungen und Gruppen, die zur Vorurteilsbildung neigen. Lebensformen, kulturelle Praktiken, die nicht ihren Vorstellungen entsprechen, werden massiv abgelehnt, mitunter als Bedrohung erlebt. Hassen dient dazu, die anderen zu entwerten und die eigene Gruppenzugehörigkeit zu markieren, nach dem Motto: Ich gehöre zu den Richtigen, du bist weniger wert. Möglicherweise haben sich die Grenzen des Sagbaren verschoben. Was sich früher nicht gehört hat, ist heute akzeptabler geworden. Wenn ich sage: „Fick dich doch, du …“, werde ich nicht unmittelbar korrigiert, vielleicht sogar dafür gefeiert, es den anderen so richtig gegeben zu haben.
Gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern?
Männer neigen eher zu hierarchischen Gruppenbildungen. Wird ein bestimmtes Zeichen von Dominanz gesetzt, zum Beispiel die „Schlampe“ adressiert, wird das Zugehörigkeitsgefühl zur eigenen Gruppe gestärkt. Die gefühlte Bedrohung durch das andere Geschlecht wird abgewehrt und Menschen mit einem spezifischen Merkmal abgewertet, gemäß: Wir haben die Macht und Deutungshoheit darüber, was richtig oder falsch ist.

Zu ihren Schwerpunkten zählen neben Sexualmedizin und Systemischer Familientherapie auch Verhaltenstherapie sowie Gruppenanalyse.
Hat es auch mit der Erziehung zu tun, ob in der eigenen Familie Fluchen und Beleidigen zum alltäglichen Leben gehören?
Das ist sicher eine begünstigende Bedingung. In der Psychologie wird das als Modelllernen bezeichnet. Wenn ein Kind mitbekommt, wie Mama oder Opa regelmäßig Schimpfwörter gebrauchen, lernt es, dass es okay ist, das zu tun. Kommt es in der Entwicklung noch zu einer positiven Verstärkung durch die Peergroup, können sich Verhaltensweisen verfestigen. Diese können sich aber durch korrigierende Erfahrungen auch wieder zum Positiven verändern.
Wenn jemand einem Mann „Du blöde Schwuchtel“ ins Gesicht sagt, was passiert mit dieser Person?
An dem sexistischen Wort „Schwuchtel“ lässt sich die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die sich in Hassreden findet, verdeutlichen. Der Beleidigende nutzt diskriminierende Begriffe, um Verachtung und Ekel auszudrücken, um sich von der anderen Person abzugrenzen. Die Motivation für Beleidigungen und Abwertungen kann auch sein, das eigene Selbsterleben zu stärken, im Sinne von: Ich fühle mich mächtig und besser, indem ich dich entwerte. Der andere Mensch wird entindividualisiert.
Haben Beleidigungen immer die Absicht, jemanden zu entindividualisieren? Manchmal sind sie nur dahergesagt.
Es kann sein, dass der Sechsjährige, der auf dem Schulhof „Ey, du dumme Sau“ sagt, nicht die Absicht hat, seinen Mitschüler zu entwerten. Er hat die Beschimpfung irgendwo gehört, imitiert sie, und alle lachen oder finden ihn stark. Manchmal handeln Menschen aus einem impulsiven Affekt heraus, um ihrem Ärger oder Frust Luft zu machen. Bevor der Verstand uns kontrolliert, ist das Gefühl da und sucht sich seinen Weg in Form von verbalen Attacken. Solange nicht mit Absicht Schaden angerichtet werden soll, ist das sehr menschlich, aber natürlich nicht immer zu rechtfertigen.

Kann Hass in Form von Sprache genauso viel Schaden anrichten wie körperliche Gewalt?
Extreme Formen der verbalen Gewalt können sogar dazu führen, dass Opfer ihren Lebensmut verlieren. Wir haben nicht viele Daten zu den spezifischen Auswirkungen von Hassrede, können aber Erfahrungen zu Auswirkungen von Diskriminierung und Mobbing oder Traumatisierungen heranziehen. Wenn die Person emotional und kognitiv sehr verletzlich ist, können massive Beleidigungen dazu führen, grundsätzlich am Guten in der Welt und sich selbst zu zweifeln. Folgen können Rückzug und Verzweiflung sein. Negative Verstimmungen können bis zu Depressionen führen. Opfer von Hassreden entwickeln oft Gefühle von Scham, Selbstzweifeln und fühlen sich schuldig, Opfer geworden zu sein. Wenn eine Politikerin öffentlich eine Position vertritt und dafür regelmäßig Hass erntet, ist sie vielleicht entmutigt und sagt sich: „Lass es doch, dich kritisch zu äußern. Du hättest das auch weniger scharf formulieren können.“
Denkfehler der Hatespeaker: 100 Likes gleich Mainstream
Was macht die digitale Welt mit den Menschen? Führt sie dazu, dass das Dunkle im Inneren mehr zum Vorschein kommt?
Das Dunkle oder die Aggressivität, die bis zum Hassen führen kann, ist in der analogen Welt ja schon da und hat auch dort immer schon ihren Ausdruck gefunden. Aber dadurch, dass wir uns in der digitalen Welt nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, erkennen wir so viel schwerer, was in dem anderen vorgeht, wenn wir ihn aggressiv angehen. Die Mentalisierungsfähigkeit, also das Lesen des anderen, geht im Netz verloren, was zu einer Enthemmung führen kann. Mancher Kommentar würde nicht gemacht, wenn die Auswirkungen auf die Menschen direkt erfahrbar wären. Durch die schnelle Verbreitung sind Hassreden auch zu einem quantitativen Phänomen geworden. Sie potenzieren sich dadurch, dass ein sogenannter Hatespeaker, also Hasser, im Digitalen viele Menschen erreichen kann. Hasskommentare werden mit Daumen-hoch-Zeichen und passenden Emoticons bestätigt, was dazu führt, dass sich der Hasser in seinem Bild von der Welt bestätigt fühlt. Um noch mehr Anerkennung zu erfahren, radikalisieren sich seine Kommentare oft noch.
Der Hatespeaker ist also machtgeil.
Er fühlt sich zumindest in seiner Annahme bestätigt. Das führt zu einer Verzerrung der Wahrnehmung, im Sinne von: Ich liege mit meiner Meinung richtig, und alle teilen sie. Das kann ein mächtiges Gefühl sein. Aber es ist ein sogenannter Bestätigungsfehler. Der Hasser, der 100 Likes und bestätigende Kommentare für seine Beleidigungen bekommen hat, denkt, dass er den Mainstream vertritt, und blendet aus, dass wahrscheinlich die große Mehrheit seine radikalen Ansichten nicht gutheißt.
In vielen Fällen handelt es sich bei Hatespeakern um eine Minderheit, die ziemlich laut ist.
Das ist der Punkt. In der Realität sind es zwar wenige, aber durch den Empörungseffekt und das Ausblenden der vielen Andersdenkenden scheint es so, als seien es sehr viele. Generell erleben Menschen negative Gefühle, wie zum Beispiel Hass und Wut, sehr intensiv. Sie sind fasziniert von Skandalen und von Bildern, die schrecklich sind – und eben von digitaler Gewalt.
Wenn ich Sie in der analogen Welt beleidige und das in Ihrer veränderten Mimik erkennen würde, wie würde ich darauf reagieren?
In einer sozial positiven Welt würden Sie sich vielleicht erschrecken und versuchen, die Situation zu beruhigen. Menschen, die durchaus mal ein Hassgefühl empfinden können und dieses verbal äußern, die aber nicht antisozial sind, sind und bleiben soziale Wesen, die Mitgefühl und Fürsorge füreinander empfinden können. Wenn ich Sie damit konfrontieren würde, dass Sie mich verletzt haben, würden Sie sich möglicherweise beschämt fühlen oder ein Schuldgefühl entwickeln. Als Konsequenz Ihres Handelns bliebe ein unangenehmes Gefühl zurück, das Sie künftig vermeiden wollen. In der virtuellen Welt gibt es diese unmittelbare Konsequenz nicht oder sehr selten.
Kann die digitale Anonymität ein Trigger sein, um in den sozialen Medien zu beleidigen?
Ein Mensch beleidigt nicht, nur weil er anonym unterwegs ist. Die Anonymität im Netz wirkt möglicherweise als Brandbeschleuniger für den Hass, der sich gegen eine bestimmte Merkmalsgruppe richtet. Selbst wenn sich eine Person tagein tagaus im Netz herumtreibt, würde sie nicht zu einem Hasser mutieren, wenn sie die Neigung zu Vorurteilen nicht bereits hätte. Aber eventuell sucht sich der Hass schneller oder heftiger seine Bahnen, und manche lassen sich im Schutze der Anonymität von den Kommentaren eines Hassers anstecken.
Hassreden zielen auf die Minderwertigkeit der anderen Gruppe ab
Sind es immer dieselben Gruppen in der Bevölkerung, die beleidigt werden?
Es werden Menschen angegriffen, die eine bestimmte Meinung vertreten, eine bestimmte Position innehaben, einen bestimmten Lebensstil erkennen lassen, eine Religion oder politische Haltung haben, für irgendetwas stehen oder vielleicht anders aussehen. Es scheint so, dass vor allem Minderheiten angegriffen werden, weil über sie eine Vorurteilsbildung schneller entwickelt wird. Bereits die Hauttönung oder kulturelle Praktik, die bei diesen Personen anders ist als bei der eigenen idealisierten Gruppe, kann ein Merkmal sein, das zu Hassäußerungen führt.
Frauen sind ja keine Minderheiten und werden auch heftig angegangen.
Das ist richtig, aber dafür repräsentieren Frauen eine Gruppe, die Positionen besetzt, die ihr, so die Ansicht der männlichen Hasser, nicht zustehen – in die Spitze der Wissenschaft und Wirtschaft zum Beispiel oder in der Politik. Es heißt dann: „Frauen haben da nichts verloren, das ist unser Bereich.“ Beleidigungen und Entwertungen dienen unter anderem dazu, die Angst vor dem Autoritätsverlust zu bewältigen, der durch die Aufhebung sogenannter natürlicher Geschlechterverhältnisse entstehen könnte. Die Mittel sind oft sexistische Kommentare oder beziehen sich auf körperliche Merkmale der Frauen.
Es geht also auch um Angst, dass die männliche Vormachtstellung infrage gestellt wird.
Genau. Was man auch sagen muss: Frauen sind nach wie vor in vielen Bereichen nicht so sichtbar, weil sie sich nicht so machtvoll darstellen wie Männer. Wenn sie überall gleichermaßen sichtbar wären wie Männer und vor allem gleichermaßen vertreten wären, würde sich die „Wir/Ihr-Unterscheidung“ als Demonstration von Machtverhältnissen aufheben. Dann gäbe es nichts mehr zum Angreifen und zum Verteidigen. Das Phänomen findet sich auch bei der Hetze gegen andere Gruppen. Die Akzentuierungen des Unterschieds sind vielfältig: „Wir Heterosexuellen sorgen dafür, dass die Menschheit nicht ausstirbt. Ihr Homos tragt nichts dazu bei.“ Solche Gedanken stecken dahinter. Hassreden zielen immer auf die Minderwertigkeit der anderen Gruppe ab. Sie beschreiben nie positive Gemeinsamkeiten.
Wie kann man gegen Hatespeaker vorgehen?
Aus psychologischer Sicht fängt es immer bei der Prävention an. Es beginnt mit dem sozialen Lernen in Kita, Schule und Elternhaus. Kindern wird nahegebracht, was Schimpfwörter oder Beleidigungen sind, was sie im anderen auslösen und wie Ärger oder auch Wut konstruktiv ausgedrückt werden können. Außerdem muss der Umgang mit neuen Medien und auch negativen Kommentaren im Unterricht stärker behandelt werden. Man könnte mit sogenannten Skills arbeiten, indem man Heranwachsenden zeigt, wie sie ihre Gefühle besser regulieren können, auf andere Meinungen und Einstellungen nicht impulsiv reagieren müssen und sich trotzdem durchsetzen können, ohne andere Menschen zu beleidigen. In Schulen können betroffene Politiker oder Wissenschaftlerinnen eingeladen werden, um von ihren Erfahrungen zu erzählen.
Was kann in den sozialen Netzwerken getan werden?
Sich solidarisch zeigen und Gegenreden starten. Wenn eine Gruppe von Menschen sich vernetzt und beschließt, einen Hasskommentator zu dominieren, indem sie etwa viele freundliche, aber klare Gegenkommentare hinterlässt, kann das Schlechte übertönt werden und die Wahrnehmung sich in Richtung positiver Kommentare verschieben. Das würde den Zielen des Hassers entgegenlaufen. Auch als Einzelperson kann man klare Kante zeigen, indem man für eine Gegenrede recherchiert, um die eigene Meinung faktenbasiert aufzuschreiben. Das ist oft mühsam, aber lohnenswert.
Viele bevorzugen, Hasskommentare zu ignorieren.
Damit kann auch ein guter Effekt erzeugt werden. Durch das Ignorieren kann der Hasskommentar bedeutungsloser gemacht und der Hasser bestenfalls zum Schweigen gebracht werden. Im Einzelfall wird der Person sogar bewusst, was sie da geschrieben hat. Das setzt, psychologisch ausgedrückt, aber eine Motivation beim Hasser voraus, alternative Gedanken und Gefühle zu erlernen, die sich dem Hassgefühl entgegenstellen. Manche Betroffene ignorieren Hasskommentare für ihr eigenes Wohlbefinden, indem sie sich mit dem „Quatsch“ nicht auseinandersetzen, oder ihre Kraft für Gegenrede ist schlichtweg erschöpft.
In den sozialen Medien gibt es Möglichkeiten, beleidigende oder gewaltandrohende Reden zu melden. Reichen diese Kontrollmechanismen aus?